Künstlerinnen- und Künstlerförderung im Bereich
der bildenden Kunst in Berlin
1992
bis 2003
Auslands- und
Arbeitsstipendien, Hannah-Höch-Preis, Ankäufe, Projekt-, Katalogförderung,
Kulturaustausch
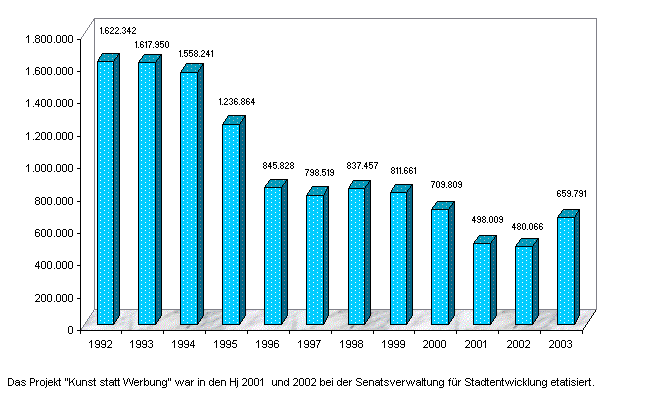
Mitteilung – zur Kenntnisnahme –
Drucksachen 15/2551 (II.B.86.), 15/3019, 15/3250,
15/3431 und 15/3431 Neu - Schlussbericht -
Der Senat legt nachstehende
Mitteilung dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor:
Der
Hauptausschuss hat in seiner 68. Sitzung am 27.02.2004 Folgendes beschlossen:
Ergänzung
der Erläuterung zu Kapitel 1730, Titel 686 15 – Zuschuss an eine Serviceeinrichtung
zur Atelierbestandssicherung:
„Neue
Verträge zur Atelierbestandssicherung werden nicht ab-geschlossen, auslaufende
Verträge nicht verlängert. Freiwerdende Mittel sind gesperrt.“
Das
Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 18. März 2004 Folgendes beschlossen
(Drucksache Nr. 15/2551 (II.B.86.):
„Die
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur wird aufgefordert, dem
Abgeordnetenhaus bis spätestens zum 30. August 2004 einen Evaluationsbericht
über die Atelierförderung in Berlin vorzulegen. In diesem Bericht sind die
Vergleichszahlen zu den anderen deutschen Großstädten und vergleichbaren europä-ischen
Metropolen darzulegen. Optional sind auch die Möglichkei-ten der Atelierförderung
unter Einbeziehung leer stehenden Wohn- und Gewerberaums in Berlin zu prüfen.“
Hierzu wird berichtet:
Evaluationsbericht über die Atelierför-derung in Berlin
Das kreative
und künstlerische Potenzial Ber-lins ist einer der wichtigsten Standortfaktoren
für die Stadt. In Berlin leben und arbeiten 4.000 - 5.000 professionelle
bildende Künstlerinnen und Künstler. Es gibt ca. 350 Galerien mit Flächen von
insgesamt 57.400 m ². Jährlich finden ca. 2.000 Vernissagen und Ausstellungen
statt. Durch die wachsende Bedeutung der
kreativen Arbeit mit digitalen Mitteln zeigt sich Berlin auch als Stadt
der Neuen Medien.
Die
Atelierförderung ist daher für Berlin im Wettbewerb der Standorte ein wichtiger
Faktor - zumal es in der Stadt
noch keinen, mit anderen Metropolen vergleichbaren Kunsthandel gibt.
Für den
künstlerischen Produktionsprozess ist das Vorhandensein einer adäquaten Arbeitsstätte
von entscheidender Bedeutung. Das gilt um so mehr, als aufgrund der veränderten
ökonomi- schen Rahmenbedingungen die Möglichkeiten der Selbstvermarktung und
der selbstständigen Arbeit in den 90er
Jahren für bildende Künstlerinnen und Künstler immer wichtiger geworden sind.
Das Atelier ist heute gleichermaßen Werkstatt, Büro, Labor, Lager,
Computerstellplatz, Ausgangspunkt für Netzwerkstrukturen und den Dialog mit der
Öffentlichkeit.
Dass
es Sinn macht, Künstlerförderung durch Atelierförderung zu betreiben, zeigt
sich auch daran, dass die mit Ateliers geförderten Berliner Künstlerinnen und
Künstler eine überdurch-schnittlich rege Ausstellungstätigkeit in Berlin und
überregional nachweisen können. Unter den rund 500 Künstlerinnen und Künstlern,
die das Programm bisher nutzen konnten, hat sich eine beachtliche Anzahl
nationale wie internationale Anerkennung erworben (u.a. Veronika Kellndor-fer,
Johannes Kahrs, Paco Knöller, Franz Acker-mann). Sie werden zu Botschaftern
Berlins und erhöhen die kulturelle und touristische Anzie-hungskraft der Stadt.
Atelierförderung
soll nicht zuletzt leisten, was vom Markt nicht erwartet werden kann, kontinu-ierliche
künstlerische Arbeit unter angemessenen Produktionsbedingungen. Dabei soll die
Förderung vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage und der
Immobiliensituation angepasst und effek-tiviert werden.
In
den letzten Jahren ist die soziale Lage der bildenden Künstlerinnen und
Künstler schwieriger geworden. Nach der Einstellung der sozialen
Künstlerförderung ist die Atelierförderung die letzte Maßnahme zur Förderung
von Künstlerinnen und Künstlern mit einer direkten sozialen
Kom-ponente.
Zuverlässige
Zahlen über die Einkommens-situation bildender Künstlerinnen und Künstler gibt
es weder für das Bundesgebiet noch für Berlin. Aus den vorhandenen Untersuchungser-gebnissen
kann als gesicherte Erkenntnis gewertet werden, dass nur ca. 5 % der professionellen
bildenden Künstlerinnen und Künstler aus diesem Beruf überhaupt ein
auskömmliches Einkommen erzielen. Alle anderen sind auf Nebenerwerb angewiesen.
In
der Antwort der Bundesregierung auf eine Große Anfrage der Fraktion der CDU/CSU
und der Fraktion der FDP über die "Wirtschaftliche und soziale Entwicklung
der künstlerischen Berufe und des Kunstbetriebs in Deutschland" vom
19.12.2003 (Drs. Nr.15/2275) werden die Daten der Künstlersozialkasse zugrunde
gelegt. Danach beträgt das durchschnittliche monatliche Einkom-men freiberuflicher
Künstler der bildenden Kunst, darstellenden Kunst und Musik monatlich 850 €. Es
wird festgestellt, dass sich die Einkünfte der selbstständigen Künstlerinnen
und Künstler von 1995 bis 2002 nominal leicht positiv, im Vergleich zu den
übrigen Erwerbstätigen aber unterdurch-schnittlich entwickelt haben.
Nicht alle
Künstlerinnen und Künstler sind Mitglied der Künstlersozialkasse. Gerade junge
Künstlerinnen und Künstler erreichen teilweise nicht das erforderliche
Einkommen von 3.900 € im Jahr, das eine Aufnahme in die Künstlersozial-kasse
ermöglicht. Die tatsächlichen Einkommen dürften also eher niedriger sein.
Nach einer im
Auftrag des Freistaats Sachsen 2000/2001 erstellten wissenschaftlichen Studie
zur sozialen Lage der freiberuflichen Künstlerinnen und Künstler im Freistaat
Sachsen betrug das durchschnittliche eigene Einkommen der Künstler dort 866 €,
Künstlerinnen verdienten durchschnitt-lich nur 645 €, davon 681 € bzw. 484 €
aus künst-lerischer Tätigkeit. Die besondere Benachteiligung von Frauen
bestätigt auch der Bericht des Bundes-ministeriums für Arbeit und soziale
Sicherung über die soziale Lage der Künstlerinnen und Künstler in Deutschland -
vorgelegt im Juni 2000 zur Vorbereitung der Reform des
Künstlersozial-versicherungsgesetzes - wonach im Jahr 2000 das Einkommen von
Künstlerinnen ungefähr ein Viertel niedriger lag als das ihrer männlichen
Kollegen. Die GEDOK Brandenburg gibt für Künstlerinnen in Brandenburg aktuell
sogar nur ein Einkommen von 250 bis 500 € im Monat an. Die besonders schwierige
Situation der Künstle-rinnen spricht dafür, auch bei der Atelierförderung in
Zukunft auf das Gender Mainstreaming zu achten.
Eine
Auswertung der Datensätze des Atelier-büros des Kulturwerks des Berufsverbandes
Bil-dender Künstler Berlin GmbH für 1999 bis 2002 hat ergeben, dass das durchschnittliche
Gesamtein-kommen (einschließlich Nebeneinkünften) pro Monat bei 759 € lag.
Gründe für die
Verschlechterung der sozialen Lage von Künstlerinnen und Künstlern sind: die
Entwicklung auf dem Kunstmarkt, weniger private Verkäufe, weniger geeignete Nebenjobs,
weniger Angebote kunstnaher Tätigkeiten sowie die Kür-zung öffentlicher Mittel
für Ankäufe, Projekte und Stipendien. Die Mittel für Kunst am Bau sind
ebenfalls geringer geworden, weil die öffentliche Bautätigkeit reduziert worden
ist. Die Förderung bildender Künstlerinnen und Künstler in Berlin bestätigt
diese Entwicklung.
Auslands- und
Arbeitsstipendien, Hannah-Höch-Preis, Ankäufe, Projekt-, Katalogförderung,
Kulturaustausch
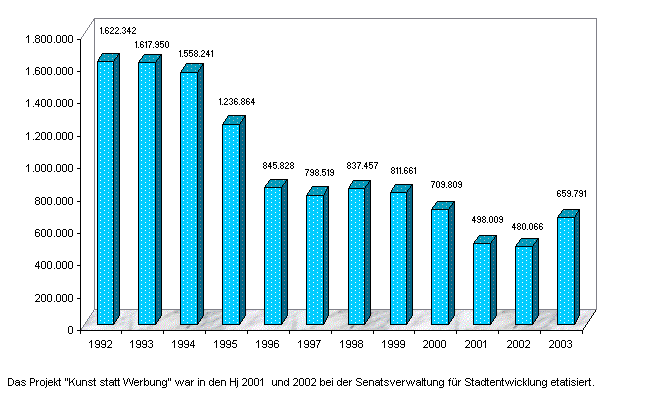
Insgesamt
gehört die Mehrheit der bildenden Künstlerinnen und Künstler trotz ihrer meist
aka-demischen Bildung zu den Berufsgruppen mit niedrigem Einkommen. Sozialhilfe
wird häufig nicht in Anspruch genommen, weil berufsfähige Sozialhilfeempfänger
für Tätigkeiten aller Art ver-mittelt werden können, der Beruf als Künstler
also aufgegeben werden müsste.
Trotz
ihres niedrigen Einkommens sind Künst-lerinnen und Künstler entgegen gängigen
Vorstel-lungen keine unzuverlässigen Zahler. Das bestätigt die Gesellschaft für
Stadtentwicklung gGmbH (GSE), die von der Senatsverwaltung für Wissen-schaft,
Forschung und Kultur mit der Durch-führung des Atelieranmietprogramms
beauftragt ist. Künstlerinnen und Künstler verdienen aller-dings unregelmäßig,
so dass Mieten gelegentlich gestundet werden müssen. Deswegen und weil
finanzielle Sicherheiten oft nicht nachgewiesen werden können, gelten
Künstlerinnen und Künstler in der Regel auf dem Immobilienmarkt nicht als solvente
Mieter.
Seit
der Gründung des Atelieranmietpro-gramms im Jahr 1993 hat sich die Lage auf dem
Immobilienmarkt erheblich verändert. Es gibt heu-te ca. 100.000 leerstehende
Wohnungen und mehr als eine Million Quadratmeter leerstehende Gewerberäume.
Durch den Strukturwandel im Ein-zelhandel und im Kleingewerbe sind
Ladenge-schäfte auf Dauer nicht mehr vermietbar. Die Mietpreise für
Gewerberäume sind unter die Preise für Wohnungsmieten gesunken. Im Rahmen von
Zwischennutzungen stehen Räume zu günstigen Bedingungen vor allem bei privaten
Vermietern oft nur gegen Übernahme der Betriebskosten zur Ver-fügung.
Viele Künstlerinnen und
Künstler, auch aus dem Ausland, zieht es nach Berlin, weil sie hier günstige
Produktionsbedingungen vorfinden. Die Gewerbemieten in Paris und in London sind
deutlich höher als in Berlin. Auch andere Kosten der Lebenshaltung sind in
Berlin vergleichsweise niedrig. Dazu kommt, dass Berlin als Stadt dauern-der
Entwicklung Künstlerinnen und Künstler Anregungen und Gestaltungsspielraum
finden: Berlin ist die einzige internationale
Metropole, in der auch junge Künstlerinnen und Künstler ihre beruflichen
Möglichkeiten erproben und Projekte realisieren können.
Leerstehende Ladenlokale
sind als temporäre Projekträume hervorragend geeignet. Wenn sie als dauerhafte
Arbeitsplätze für Künstlerinnen und Künstler genutzt werden, kann es mit
Vermietern durchaus zu Zielkonflikten kommen:
-
Es
wird häufig erwartet, dass aus dem „Kunst-laden“ heraus ohne finanzielle Gegenleistun-gen
ein regelmäßiges öffentlichkeitswirksa-mes Kulturangebot gemacht wird.
-
In vielen Fällen soll die künstlerische
Produk-tion im Schaufenster sichtbar sein, um den gewünschten Belebungseffekt
zu erzielen. Die meisten Künstlerinnen und Künstler lehnen das ab.
-
Das Verhältnis von Produktionsfläche zu La-ger-
und Verkehrsfläche ist bei Ladenlokalen oft wesentlich ungünstiger als bei
eigens zu Atelierzwecken aufgeteilten Fabriketagen.
-
Die angebotenen Flächen liegen oft nur
ge-ringfügig unter den zum Beispiel im Atelier-anmietprogramm realisierten
Anmietungsprei-sen.
-
Ein Projekt „Kunst in leeren Läden“ musste
eingestellt werden, weil lärmbedingte Nach-barschaftskonflikte nicht zu lösen
waren.
Grundsätzlich
ist festzustellen: Auch Zwi-schennutzungskonzepte sind nicht kostenneutral.
Technische Objekteigenschaften wie die Qualität der Erschließung und
baurechtliche bzw. brand-schutztechnische Notwendigkeiten sind jeweils abhängig
von der entsprechenden Bestandsqualität durchaus Kostenfaktoren, die ein
Zwischennut-zungskonzept insgesamt in Frage stellen können.
„Kunst in
leeren Läden“- Konzepte sind an-gesichts des Fehlens von
Präsentationsmöglichkei-ten für Kunst aus Berlin in Berlin durchaus als
Entwicklungsfeld anzusehen, können aber Atelier-häuser und -zentren als Kommunikations-
und Produktionsräume nicht ersetzen.
Viele
Künstlerinnen und Künstler leben in Wechselwirkung mit dem Stadtteil- und Quartiers-geschehen.
Unterschiedliche künstlerische Produk-tionsweisen erfordern unterschiedliche
Werkstatt-zuschnitte und Stadtlagen. Für manche ist ein Netzwerk von
Kooperationspartnern in erreichba-rer Nähe erforderlich. Da die meisten
Künstler nicht von ihrer künstlerischen Arbeit leben können, dürfen die
Entfernungen zwischen den Le-bensbereichen künstlerische Produktion –
Er-werbsarbeit – Familie nicht so groß sein, dass lange Fahrzeiten erforderlich
sind. Größe und Aus-stattung eines Künstlerarbeitsplatzes sind ebenfalls von
der künstlerischen Produktion abhängig: ein Videokünstler braucht für seine Arbeit
andere Voraussetzungen als ein Bildhauer, eine Bildhaue-rin oder ein Maler,
eine Malerin.
Der
Atelierbeauftragte gibt die notwendige Ateliergröße für bildende Künstlerinnen
und Künstler mit 60 m² an. Tatsächlich sind
viele Künstlerinnen und Künstler wirtschaftlich nicht mehr in der Lage, sich
Ateliers dieser Größe zu leisten. Kleinere Ateliers wären für viele von ihnen
eine Lösung, wenn es einen geeigneten Lagerraum für ihre Kunstwerke gäbe. Da
solche Lagerräume derzeit selten vorhanden sind, wird das Atelier selbst auch
als Lagerraum genutzt. Dafür sind Atelierflächen eigentlich zu teuer. Die Lagerung
von Kunstwerken in Ateliers erschwert Umzüge, weil sie als Kunsttransporte mit
entsprechendem Aufwand organisiert und bezahlt werden müssen.
Besonderes
Augenmerk sollte auf die Entwick-lung des Wohnungsmarkts gelegt werden, weil
nach Untersuchungen des IFO-Instituts und des Atelierbüros fast die Hälfte der
Künstlerinnen und Künstler in der eigenen Wohnung arbeitet. Zu be-rücksichtigen
ist hierbei, dass nach den Erhebun-gen des Atelierbüros gut die Hälfte der
Befragten in Mehrpersonenhaushalten lebt und zum Arbeiten eigentlich ein
zusätzliches Zimmer benötigt. Die Zahl der hierfür geeigneten Großwohnungen hat
im Zuge der intensiven Stadterneuerung in Berlin stark abgenommen.
Als die
Gewerbemieten nach dem Fall der Mauer rasant anstiegen, wurde die Sicherung von
Künstlerarbeitsplätzen in Berlin zur politischen Aufgabe. Seit 1991 fördert die
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur das Atelierbüro beim
Kulturwerk des Berufsverbands Bildender Künstler Berlins (BBK). Dass die Arbeit
insgesamt erfolgreich war, zeigt die folgende Übersicht:
Neue geförderte Ateliers
in Berlin von 1993-2004:
|
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
1993-2003 |
2004 |
|
Senatsverwaltung für Wissenschaft,
Forschung und Kultur * |
13 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-13 |
40 |
|
|
SenWissKult
/ Atelieranmietprogramm |
6 |
73 |
42 |
11 |
44 |
27 |
6 |
49 |
-20 |
36 |
88 |
362 |
|
|
Sonderprojekte Atelieranmietprogramm |
|
|
9 |
|
|
8 |
42 |
8 |
|
|
|
67 |
|
|
Förderprogramme
der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung** |
4 |
5 |
4 |
26 |
15 |
32 |
41 |
61 |
29 |
28 |
33 |
278 |
37 |
|
Gesamt: |
23 |
118 |
55 |
37 |
59 |
67 |
89 |
118 |
9 |
64 |
108 |
747 |
784 |
·
13 Ateliers und 10 Freiflächen für Bildhauer auf
dem Künstlerhof Buch stehen zukünftig nicht mehr zur Verfügung
(Liegenschaftsfonds).
40 Ateliers befinden sich in den
Atelierhäusern Adlershof und Schnellerstraße.
** Die Anzahl der Ateliers, die im Rahmen
der unterschiedlichen Förderprogramme der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung entstanden sind, wurden nach
den im Atelierbüro registrierten Belegrechten aufgeführt.
Insgesamt
gab es 2003 in Berlin 859 strukturell gesicherte Ateliers und Atelierwohnungen.
Als strukturell gesichert werden Ateliers gewertet, für die Belegungsrechte bei
Bezirken, der Senatsver-waltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur bzw.
beim Atelierbüro existieren. Zusätzlich wur-den weitere 597 Ateliers bei freien
und privaten Trägern ermittelt, die teilweise aus öffentlichen Mitteln
gefördert wurden (Anlage 1/1.5).
Strukturell
gesicherte Ateliers und Atelierwohnungen in Berlin 2003
|
Senatsverwaltung
für Wissenschaft, Forschung und Kultur: Atelierhäuser und Atelieranmietprogramm
(50+362) |
412 |
|
Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung |
278 |
|
Bezirke
(Gesamtanzahl der Ateliers in den Bezirken
132, davon
87 Ateliers mit Belegrechten, 45 Ateliers vergibt ein Freier Träger ) |
87 |
|
Wohnungsbaugesellschaften Altbestände |
26 |
|
Freie
Träger (Belegrechte) |
56 |
|
Strukturell
gesicherte Ateliers und Atelierwohnungen gesamt: |
859 |
|
zzgl.: |
|
|
Freie
Träger und Private Atelierhäuser / Gesamt
608 abzgl. o.g. Freier Träger 56 und zzgl. 45 Freier Träger des Bezirks |
597 |
|
Gesamt: Ateliers
und Atelierwohnungen |
1.456 |
4.1
Ateliersituation und Atelierförderung in den
Bezirken
Künstlerateliers sind
Bestandteil der kulturellen und sozialen Infrastruktur der Stadtteile. Deshalb
haben auch die Bezirke Interesse an Atelierstand-orten. Einige von ihnen verfügen
über eigene Ate-liers, die meistens durch die für Kultur zuständige Stelle bzw.
einen Beirat vergeben werden (Anlage 1 /1.3). Andere sehen sich weder
personell noch f
finanziell in der Lage, Ateliers zu verwalten und
kooperieren deshalb mit dem Atelierbüro beim Kulturwerk des BBK.
Im Rahmen des
Quartiersmanagements spielt die Neu-Errichtung von Künstlerateliers eine
untergeordnete Rolle. Bereits vorhandene Atelier-standorte sind jedoch für die
Durchführung von Projekten des Quartiersmanagements von Bedeu-tung. Im Quartier
Soldiner Straße (Bezirk Mitte) werden z.B. vom Quartiersmanagement mit
Unter-stützung der DEGEWO
leerstehende Läden als
Orte von Kunstpräsentation im Rahmen
einer Zwischennutzung gegen Zahlung der Betriebskos-ten vergeben. Die Nutzung
hat zu einer Belebung des Kiezes geführt.
Im Einzelnen
wird die Ateliersituation von den Bezirken wie folgt bewertet:
Die Ateliersituation hat
sich im Bezirk Mitte in den letzten Jahren verschlechtert, da durch
Eigentümerwechsel und Sanierung viele der Ate-liernutzungen aus dem Anfang der
90er Jahre nicht mehr zur Verfügung stehen oder nicht mehr bezahlbar sind. Dies
gilt insbesondere für den Altbezirk Mitte. Einige der Künstlerateliers konn-ten
durch Förderprogramme der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gesichert werden, andere wurden durch das
Atelieranmietprogramm ersetzt. Die Künstlergemeinschaft APPARAT e.V. mit ca. 60
Ateliers und die Künstlerateliers Schlegelstr. 9 konnten nicht erhalten werden.
Die Künstlerinnen und Künstler des seit vielen Jahren bedrohten
"Milchhofs" mit ca. 42 Ateliers werden mit Unter-stützung des
Bezirks, des Atelierbüros und der Gesellschaft für Stadtentwicklung (GSE) in
einer ehemaligen Schule in der Schwedter Straße unter-gebracht.
Friedrichshain – Kreuzberg
gehört
zu den innerstädtischen Bezirken mit den meisten Künst-lerinnen und Künstlern.
Das schafft eine erhöhte Nachfrage nach Atelierräumen. Aufgrund der
in-nerstädtischen Lage treten die Künstlerinnen und Künstler hier in unmittelbare
Konkurrenz mit oft solventeren Mietern anderer Kreativ-Branchen (Musik, Medien,
Architektur, Design etc.), die unter ähnlichen Bedingungen (in Fabriketagen
u.ä.) arbeiten.
Der Bezirk Neukölln
profitiert insbesondere im Norden und dort noch einmal besonders in den
Gebieten mit Quartiersmanagement von den zahl-reichen dort ansässigen
Künstlern, weil viele von ihnen ihr Atelier nicht nur als temporären
Arbeits-ort begreifen, sondern sich in sozialen Zusammen-hängen ihres Quartiers
engagieren. Bemerkenswert viele Kunstprojekte wurden durch die Quartiers-fonds
unterstützt. Insbesondere an der Schillerpro-menade und im Reuterkiez haben
sich Künstler-netzwerke entwickelt. Voraussetzung dafür waren die Ateliers, die
dort entwickelt werden konnten. Temporär leerstehende Räume im Körnerpark oder
im Alten Krankenhaus Neukölln wurden bereits in der Vergangenheit für
Atelierzwecke genutzt. Der Stadtrat für Bildung, Schule und Kultur kritisiert,
dass die Ateliervergabe durch die Fachkommission des BBK ohne Mitwirkung des
Bezirks erfolgt.
Der Bezirk Treptow-Köpenick
vergibt keine eigenen Ateliers. Im Bezirk befinden sich mehrere Atelierhäuser
(Kunstfabrik am Flutgraben, Atelier-haus Mengerzeile, Atelierhaus Adlershof),
so dass das Angebot an Künstlerarbeitsstätten abgesehen von noch vorhandenen
Baumängeln insgesamt als gut bezeichnet wird. Die Karl Hofer Gesellschaft betreibt
14 Ateliers in Oberschöneweide. Der Standort hat sich trotz sehr schöner Umgebung
als äußerst problematisch erwiesen, weil die soziale Situation im Quartier
schwierig ist und Sammler und Mäzene nur mit Mühe zu Ortsterminen zu bewegen
sind. Die Karl Hofer Gesellschaft hat ihre Absicht, den Standort aufzugeben,
einstweilen fallengelassen, weil die GSE und das Atelierbüro in der
Nachbarschaft mit einem privaten Investor ein Atelierhaus planen, das zur Belebung
des Kiezes führen könnte.
Im Bezirk
Tempelhof-Schöneberg gibt es (noch) zahlreiche Ateliers/Atelierwohnungen,
die von Künstlerinnen und Künstlern direkt auf dem freien Markt bzw. von
Wohnungsbaugesellschaf-ten gemietet werden. In einigen Häusern/ehema-ligen
Fabriketagen konzentrieren sich mehrere Ateliers, die bei Auszug an andere
Künstler weiter-gereicht oder zwischengenutzt werden. Allerdings ist die
Tendenz seit den 90 er Jahren extrem rückläufig bei eher gestiegener Nachfrage.
Beim Kulturhaus
Kyffhäuser Straße 23, in dem neben vier Vereinen, einer deutsch-türkischen
Musik-schule, dem Theater Strahl, zwei Musikgruppen und einer Galerie auch 18
bildende Künstlerinnen und Künstler untergebracht sind, handelt es sich um eine
ehemalige Schule, deren Verwaltung von der GSE übernommen wurde. Mit einer
einma-ligen Investition von 100.000 DM des Bezirksam-tes und von weiteren
80.000 DM aus dem Atelieranmietprogramm erfolgte die Herrichtung der Räume.
Laufende Zuschüsse sind nicht erfor-derlich.
Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gibt es neben zwei Objekten
(18 Ateliers), die durch den Bezirk für
Atelierzwecke zur Verfügung ge-stellt werden, private Ateliers und Atelierhäuser.
Die Ateliersituation in Steglitz-Zehlendorf
ist regionaltypisch. Der bürgerliche Bezirk mit einer weiträumigen
Einfamilienhausstruktur hat wenige Baulichkeiten, die sich zur Nutzung als
Ateliers eignen. Die meisten Künstlerinnen und Künstler haben Ateliers in ihren
Privatwohnungen bzw. -häusern. In
der Schwartzschen Villa stellt der Bezirk Künstlerinnen und Künstlern für einen
Zeitraum von bis zu drei Wochen ein Atelier kostenlos für besondere Produktionen
zur Verfü-gung. Für die Belegung sorgt der Fachbereich Kultur.
In Spandau
haben 42 Künstlerinnen und Künstler Ateliers in bezirkseigenen Immobilien
(Zitadelle Spandau, ehemaliges Zollhaus Heer-straße, Remise Dorfschule Kladow).
Eine öffent-liche Förderung gibt es nicht. Die Vergabe erfolgt durch das
Kunstamt. Zusätzlich sollen die ehema-ligen Lagergaragen im Schulgebäude
Kant-Gym-nasium für Atelierzwecke genutzt werden. Kosten entstehen dem Bezirk
nicht. Die Ateliersituation könnte auf Grund des Leerstandes von bundes-eigenen
Gebäuden und Firmen weiter entwickelt werden.
Das Bezirksamt Reinickendorf
stellt ca. 45 Künstlerinnen und Künstlern Ateliers bis 2023 im „Künstlerhof
Frohnau“ zur Verfügung. Der Nut-zungsvertrag mit zwei Trägervereinen, die auch
für die Vergabe zuständig sind, beinhaltet eine Option bis zum Jahr 2043. Neben
dem Künstlerhof exis-tiert im Bezirk das Kunstzentrum Tegel-Süd, in dem ca. 40
Künstler tätig sind. Eine besondere Nachfrage nach Ateliers existiert nach
Auffassung des Bezirksamtes nicht. Im Eigentum der Ober-finanzdirektion
befinden sich in der Namslaustraße ehemalige Lagerhallen, die sich für die
Atelier-nutzung eignen könnten und nur zum Teil ander-weitig vermietet sind.
Der Bezirk Pankow
sieht sich mit seinen Orts-teilen Prenzlauer Berg, Pankow und Weißensee nach
wie vor als wichtigen Produktionsstandort für bildende Künstlerinnen und
Künstler. Durch Verwertungsinteressen bedingte Verdrängungsten-denzen von
Künstlerinnen und Künstlern sind der-zeit nur punktuell erkennbar. Dieser
Umstand resultiert nicht zuletzt aus der derzeitigen Situation des
Immobilienmarktes. Nach wie vor besteht jedoch ein Bedarf an bezahlbaren
Ateliers. Insbe-sondere der Ortsteil Prenzlauer Berg ist als Ar-beitsort für
eine junge und zum Teil internationale Künstlerschaft Anziehungspunkt und
benötigt preiswerte Räume für eine Ateliernutzung. In den Ortsteilen Pankow und
Weißensee ist der Bedarf an Ateliers durch die vorhandenen Ateliers und
Atelierhäuser weitgehend gedeckt. Die
Vergabe der bestehenden Atelierhäuser und -wohnungen im Bezirk erfolgt
mehrheitlich durch das Atelierbüro beim Kulturwerk des BBK Berlin. Die Zusam-menarbeit
mit dem Atelierbüro hinsichtlich der Schaffung und Vergabe der Ateliers wird
als sehr gut bezeichnet.
Der Bezirk Lichtenberg
stellt bisher keine Räume für Atelierzwecke zur Verfügung. Im Rah-men der
Sanierung des Stadthauses im Kaskelkiez wird eine Atelierwohnung für 1-2
Künstler ent-stehen, die durch eine unabhängige Jury vergeben werden soll. Der Bezirk ermittelt zurzeit, wie hoch der
Bedarf ist und prüft, welche Liegenschaften für Künstlerinnen und Künstler zur
Verfügung gestellt werden können. Vor dem Hintergrund verschiede-ner
Förderkulissen siedeln sich in Lichtenberg Mitte und Süd in zunehmendem Maße
Künstle-rinnen und Künstler an. Verstärkt zu werden scheint diese Tendenz durch
die Ateliersituation in der Innenstadt sowie durch die besondere
stadt-räumliche Qualität der einzelnen Quartiere (Plat-tenbau in der
Sewanstraße, Neu-Hohenschön-hausen), Rummelsburger Bucht (private Atelier-häuser),
Altbausubstanz wie in Friedrichshain (Victoriastadt).
Die Ateliersituation in Marzahn-Hellersdorf
wird vom Bezirk als äußerst negativ beschrieben. Keine der von den
Wohnungsbaugesellschaften betriebenen Atelierwohnungen wird noch von
Künstlerinnen und Künstlern bewohnt. Alle Be-mühungen, diese Wohnungen mit Unterstützung
des Atelierbüros zu vermieten, waren erfolglos. In Alt-Marzahn 25 wurde der
gesamte Atelierhof leergezogen, in dem in den 90er Jahren noch 5 Künstler
lebten und arbeiteten. Grund dafür waren Preissteigerungen. Die
Wohnungsbaugesellschaft will die Immobilie verkaufen. Gegenwärtig be-nennt der
Bezirk vier Schulen und eine Kinder-tagesstätte, die für Ateliernutzung geeignet
wären. Darüber hinaus wird durch die Treuhand Liegen-schaftsgesellschaft (TLG)
geprüft, ob ein leerste-hendes Kaufhaus am Helene-Weigel-Platz für tem-poräre
kulturelle Nutzung offen steht.
Atelierwohnungen
sind traditionell in West-Berlin im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus er-richtet
worden. Da es jedoch weder eine spezifi-sche Belegungsbindung für Künstler noch
ein Ver-fahren für die Belegung gab, wurden diese Woh-nungen nach und nach
zweckentfremdet. Die Zahl der geförderten Atelierwohnungen ist nicht be-kannt.
In Ost-Berlin
unterstanden Ateliers und Ate-lierwohnungen der zentralen Gewerberaumlen-kung.
Freiwerdende Atelierräume wurden dem Bezirksstadtrat für Kultur und dem Magistrat
gemeldet. Der Magistrat informierte den Verband Bildender Künstler, der einen
Künstler oder eine Künstlerin benannte. Die Benennung wurde vom Magistrat an
die zentrale Gewerberaumlenkung weitergeleitet. Die Senatsverwaltung für
Wissen-schaft, Forschung und Kultur übernahm die Belegungsrechte nach 1990 und
gab die Freimel-dungen an den Berufsverband Bildender Künstler Berlins (BBK)
bzw. das Atelierbüro weiter.
Zu diesem
Zeitpunkt verfügten die Wohnungs-baugesellschaften, die den Bestand übernommen
hatten, über rund 400 Ateliers und Atelierwoh-nungen in Ost-Berlin. In den Altbaugebieten
Fried-richshain und Prenzlauer Berg sind Ateliers und Atelierwohnungen im Zuge
von Restitution verlo-ren gegangen. Ateliers aus dem Bestand der WBG Mitte
(Strausberger Platz) sowie Friedrichshain (Frankfurter Allee, Bersarinplatz und
Rigaer Straße) wurden veräußert. Belegrechte wurden hier 1999 letztmalig
wahrgenommen. Für eine Reihe von Ateliers in Marzahn und Friedrichshain musste
in den vergangenen 10 Jahren auf die Belegrechte verzichtet werden, da wegen
der ho-hen Mieten kein Nachmieter gefunden werden konnte. Heute gibt es aus
diesem Bestand nur noch für 26 Ateliers/Atelierwohnungen Belegrechte (Anlage 1,
1.4).
Seit 1995
existiert für Ateliers und Atelier-wohnungen, die mit Programmen der Senatsver-waltung
für Stadtentwicklung gefördert werden, eine spezifische Belegungsbindung, die
von der Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem
Büro des Atelierbe-auftragten beim Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender
Künstler und der Berufsvertretung Bildender Künstler ausgeübt wird
(Abgeordneten-haus Drs. Nr. 12/4080). Seither hat die Senatsver-waltung für
Stadtentwicklung verstärkt im Rahmen unterschiedlicher Programme Ateliers und
Atelier-wohnungen gefördert.
Im Rahmen der
Grundförderung des sozialen Wohnungsbaus (Kapitel 1295 (alt 1290), Titel 663 10
und 863 33) verfolgt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung seit 1994 das
Ziel, jährlich 50 Atelierwohnungen zu fördern. Es wurden 8 Ate-lierwohnungen
geschaffen. Ab 1998 wurden durch den Ausstieg aus der Förderung des sozialen
Woh-nungsbaus keine weiteren Atelierwohnungen mehr errichtet.
Im Rahmen der
Förderung der Modernisierung und Instandsetzung (Kapitel 1295 (alt 1290), Titel
893 56) „ModInst RL 95 - soziale Stadterneue-rung“ und „ModInst RL 96 -
Wohnungspolitische Selbsthilfe“ sind
rund 240 Ateliers und Atelier-wohnungen entstanden.
Im Rahmen des
Förderprogramms Städtebau-licher Denkmalschutz entstanden 12 Atelierwoh-nungen.
Insgesamt hat die
Senatsverwaltung für Stadt-entwicklung seit 1993 im Rahmen ihrer Förderpro-gramme
rund 278 Ateliers gefördert (Anlage 1, 1.2). Aus den inzwischen eingestellten
Förder-programmen werden noch weitere 7 Atelierwoh-nungen und 30 Ateliers fertiggestellt, so dass mittelfristig
rund 315 Ateliers zur Verfügung stehen. Die Belegungsbindung für die ModInst-Förderung
läuft 2018 aus, so dass der Bestand nur bis zu diesem Zeitpunkt gesichert ist.
Die
aus den Förderprogrammen der Senatsver-waltung für Stadtentwicklung
entstandenen Ate-liers und Atelierwohnungen werden ohne zeitliche Befristung vergeben.
Das entspricht den Interessen der meisten Künstlerinnen und Künstler, die
dauerhafte Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten brauchen. Fast die Hälfte der
Künstlerinnen und Künstler möchte Wohnen und Arbeiten verbinden und sucht eine
Atelierwohnung. Die derzeit zu zahlenden Mieten in Höhe von 7,09 € pro m² sind
inzwischen auch für Künstlerinnen und Künstler mit Wohnberechtigungsschein so
hoch, dass einige Wohnungen jeweils für die einzelne Vermietung von der
Belegungsbindung freigestellt werden mussten.
Die öffentliche
Ausschreibung der durch Pro-gramme der Senatsverwaltung für Stadtentwick-lung
geförderten Ateliers übernimmt das Atelier-büro. Bewerben können sich professionelle
Künstlerinnen und Künstler. Die Vergabe erfolgt durch die sog. Fachkommission,
die von der Mit-gliederversammlung des BBK Berlins gewählt wird. Sie soll aus
mindestens 10 und höchstens 13 Künstlern bestehen. Zwei weitere Mitglieder
können Sitz und Stimme in der Fachkommission erhalten. Ein weiteres Mitglied
kann vom Deut-schen Künstlerbund benannt werden. Ist ein zu vergebendes Objekt
für die kulturelle Infrastruktur eines Berliner Bezirks von besonderer
Bedeutung, kann der Kulturamtsleitung bei der entsprechenden Vergabe ein
Vorschlagsrecht eingeräumt werden. Die Senatsverwaltung für Wissenschaft,
Forschung und Kultur ist nicht eingebunden.
Derzeit besteht
die Fachkommission aus 12 von der BBK-Mitgliederversammlung gewählten
Künstlerinnen und Künstlern und zwei Vertrete-rinnen des Deutschen
Künstlerbundes. Die Kom-mission hat 2003 sechs Mal getagt. Einige Bezirke
klagen über mangelhafte Kommunikation.
Die folgende
Tabelle zeigt, dass auf ein ausge-schriebenes Atelier in den letzten Jahren
ungefähr zwei Bewerbungen entfielen. Diese relativ komfor-table Bewerbersituation
muss nicht bedeuten, dass der Bedarf an Ateliers gering ist. Sie kann auch ein
Hinweis darauf sein, dass viele Künstlerinnen und Künstler sich die angebotenen
Ateliers nicht leisten können und sich deshalb auch nicht be-werben.
Ateliervergaben über die
Fachkommission des Berufsverbands Bildender Künstler Berlins
1994
bis 2003
|
Jahr |
Anzahl der Atelier- vergaben |
Anzahl der Bewerbungen
(ohne Alternativ-bewerbungen*) |
Bewerber pro Jahr |
|
1994 |
31 |
59 |
57 |
|
1995 |
30 |
74 |
65 |
|
1996 |
24 |
91 |
75 |
|
1997 |
5 |
20 |
17 |
|
1998 |
37 |
138 |
90 |
|
1999 |
53 |
103 |
87 |
|
2000 |
52 |
124 |
104 |
|
2001 |
58 |
112 |
100 |
|
2002 |
62 |
141 |
125 |
|
2003 |
73 |
126 |
116 |
|
Summe: |
425 |
988 |
836 |
* Künstler und Künstlerinnen
bewerben sich häufig in einer Vergaberunde auf mehrere Ateliers.
Die angegebenen Zahlen
spiegeln nur die Bewerbungen auf das Atelier mit der 1. Priorität wider.
Einige Bewerber haben
sich im laufenden Jahr mehrfach beworben.
Quelle: Atelierbüro des Kulturwerk des BBK Berlins GmbH 2004
Das Atelierbüro
hat erheblichen Anteil daran, dass die Förderprogramme der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung für Ateliers genutzt werden konnten. In den Jahren 1996 bis
2001 bildete die fachliche Beratung bei der Umsetzung der Pro-gramme einen
Arbeitsschwerpunkt des Atelierbe-auftragten. In enger Kooperation mit den
zustän-digen Fachverwaltungen wurden die Planungen mit Architekten und
Bauherren abgestimmt, jede Atelierwohnung wurde besichtigt und technische
Eigenschaften beurteilt. Für größere Vorhaben wie Atelierhäuser Bizetstraße,
Langhansstraße, Christi-nenstraße wurden mit den Gebietsbetreuern der
Sanierungsgebiete zusammen Investoren gesucht.
Seit Auslaufen
der Wohnungsbauförderpro-gramme bemüht sich der Atelierbeauftragte um eine
stärkere Berücksichtigung des Atelierbaus in den Programmen „Stadtumbau Ost“
und EFRE- Mitteln (Meinblau e.V., Oberschöneweide).
4.3
Atelierförderung der Senatsverwaltung für
Wissenschaft, Forschung und Kultur
Die
Senatsverwaltung für Wissenschaft, For-schung und Kultur verfügt über 50 eigene
Ateliers. Sie fördert Kulturinstitutionen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit
Ateliers zur Verfügung stellen, und sie finanziert das Atelierbüro beim
Kulturwerk des Berufsverbands Bildender Künstler Berlins sowie das Atelieranmietprogramm.
·
Analyse
der Ateliersituation durch statistische Untersuchungen und Umfragen, somit
Ermitt-lung des Ist-Bestandes und des notwendige Sollbestandes an Ateliers,
ihrer Qualitäts-anforderungen, Standards und Rechtsformen,
·
Konzeptentwicklung
von Förderinstrumenta-rien, die lang- und mittelfristig neue Ateliers
ermöglichen und kurzfristig bestehende Ate-liers sichern sollen,
·
Suche,
Erschließung und Beschaffung von Ateliers im Rahmen der bestehenden
Förder-möglichkeiten, Kontrolle bei der Durchfüh-rung und Umsetzung der Programme,
·
beratende
Funktion für öffentliche und private Bauherren, Architekten und für Senats- und
Bezirksverwaltungen,
·
Information
und Beratung von Künstlerinnen und Künstlern, Ausschreibung zu vergebender
Ateliers und Atelierwohnungen, Rechts- und Verhandlungsbeistand bei drohender
Mieter-höhung oder Kündigung,
·
Sicherstellung
der auf Transparenz und Chan-cengleichheit basierenden Förderstruktur,
·
Geschäftsstellenfunktion
der Ateliervergabe-gremien (Beirat für das Atelieranmietpro-gramm und
Fachkommission des BBK), Kontrolle der Einhaltung der Vergaberichtli-nien.
Das
Atelierbüro vermittelt freie Angebote (auch temporär) an nationale und internationale
Künstlerinnen und Künstler. Es werden im Durch-schnitt 20 Räume pro Monat
angeboten. Die Ange-bote werden vom Atelierbüro aufgenommen, ge-prüft und ins
Internet gestellt. Nach drei Wochen oder gemeldetem Vermittlungserfolg werden
sie wieder gelöscht.
Nach
Auskunft des Atelierbeauftragten wurden für den Stadtteil Prenzlauer Berg
Potentialanalysen „kulturelle Infrastruktur“ erstellt. Auch für den Bezirk
Mitte wurde in der Zusammenarbeit Atelierbüro – Bezirksamt ein umfassender
Kultur-bericht erarbeitet. Hierzu hat das Atelierbüro eige-ne Untersuchungen
der Eigentumsverhältnisse für die ermittelten Standorte durchgeführt und eine
entsprechende Entwicklungsprognose erstellt. Die Zusammenarbeit mit den
jeweiligen Gebietsträgern für die Sanierungsgebiete in diesen Bezirken war
entsprechend intensiv: In den Gebieten um die Ackerstraße in Mitte und am
Teutoburger Platz und am Helmholzplatz in Prenzlauer Berg entstanden viele der
insgesamt rund 300 existierenden Atelierwohnungen. Hier erarbeitete das
Atelierbüro gemeinsam mit den Investoren die baulichen Konzepte. Die jeweilige
Zustimmung des Atelierbüros zur Planung war Fördervoraus-setzung, denn es ist
laut Richtlinie verfahrens-beteiligt, auch im Bezug auf die Ausübung der
Belegrechte.
Für viele Baudenkmäler ist
die kulturelle Nach-nutzung sinnvoll. Ein Beispiel ist die denkmalge-schützte
Kunstfabrik am Flutgraben. Die heute selbstverwaltete
Ateliergemeinschaft mit über 45 Arbeitsplätzen wurde gemeinsam mit den
ur-sprünglich dort arbeitenden 5 Künstlerinnen und Künstlern vom Atelierbüro beratend
strukturiert. Der Atelierbeauftragte führte maßgeblich die Ver-handlungen mit
dem Eigentümer und gestaltete die Mietverträge für die An- und für die
Vermietung inhaltlich. Die heute dort arbeitenden Künstlerin-nen und Künstler
wurden über Ausschreibungen des Atelierbüros an das Projekt herangeführt.
Laufende Subvention von Mieten ist wegen des günstigen Mietpreises nicht notwendig.
Gemeinsame
Projektentwicklungen von Quar-tiersmanagement und Atelierbüro fanden bzw.
finden im Gebiet „Beusselkiez“ und in
der Soldi-ner Straße statt. Hier soll ein leerstehendes Gebäu-de der BEWAG zu
einem „Kulturwirtschaftlichen Gründerzentrum“ umgenutzt werden. Das Projekt
soll modellhaft als gemeinsamer Standort für Bil-dende Künstlerinnen und
Künstler und Freibe-rufler aus der „Kulturwirtschaft“ entwickelt wer-den.
Selbsthilfeprojekte
Künstlerinnen
und Künstler haben in baulichen Selbsthilfeprojekten selbstverwaltete Atelierhäuser
geschaffen. In der Betreuung durch das Atelier-büro wie zum Beispiel durch
Anschubhilfe im Management, Gestaltung der Verwaltungsstruk- turen, Consulting
in der Entwicklung von bau-lichen Grundmaßnahmen wie Heizungseinbau oder
Brandschutzmaßnahmen gelingt es oft, die Künst-lerinnen und Künstler in die
Selbstverwaltung zu „entlassen“. So bilden sich subsidiäre Strukturen, die
staatliches Handeln und Fördern überflüssig machen. Beispiele dafür sind
ARTacker e.V. , Axel-Springer Straße 39, Gerichtstraße 23, Klausenerplatz 19,
Atelierhaus Mengerzeile, Atelierhaus auf der Schleusseninsel, Panzerhalle
Großglienicke, Schöneberger Ufer 71,
Charlotten-burger Ufer 16/17, Culturlawine e.V., Kunstfabrik am
Flutgraben und Milchhof e.V..
Die
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sind interessiert, Künstlerinnen und
Künstler zur Nutzung leerstehender Ladengeschäfte zu motivie-ren. Die DEGEWO
bietet im Bereich Schweden-straße 8 Läden für den Mietpreis von 4 € mtl./
m²/warm zur Vermittlung an Künstlerinnen und Künstler, allerdings nur jeweils
mit ungesicherten unbefristeten Mietverhältnissen an. Mit der GESOBAU wird
aktuell über ein „Paket“ ver-handelt. Mit der Gesellschaft STADT und LAND wurde
das Projekt Feurigstraße 67/68 gemeinsam gestaltet. Die Ateliers werden derzeit
vermietet.
Ateliernetzwerk als Fenster in den aktuellen
Kunstbetrieb
Im
Rahmen der Initiative „Impuls für Kunst“ war das Atelierbüro gemeinsam mit dem
Haupt-stadtbüro des Goethe-Instituts und der Akademie der Künste Veranstalter
von „Kunst kundlichen Stadtrundfahrten“ für das diplomatische Corps und
internationale Kulturinstitute.
Seit
Mitte der 90er Jahre veranstalten einige Bezirke in Kooperation mit dem
Atelierbüro „offene Ateliers“, so die „Kunstmeile“ in Mitte und die „Refugien“
in Prenzlauer Berg.
Für
die Zukunft hat sich das Atelierbüro fol-gende neue Ziele gesetzt:
·
Ausbau der Zusammenarbeit mit den ausländi-schen
Kulturinstituten
·
Entwicklung eines „International Studio
Pro-gramm Berlin“ als Atelierhaus mit Artists in residence
·
Intensivierung der europäischen Zusammenar-beit
mit anderen Atelierentwicklungsgesell-schaften und Aufbau eines internationalen
Atelieraustauschportals im Internet
·
Beteiligung an der Kulturwirtschaftsinitiative
unter Wahrung der Interessen bildender Künstlerinnen und Künstler
Annähernd die
Hälfte der im Rahmen der Ate-lierförderung insgesamt angebotenen, strukturell
gesicherten Künstlerarbeitsstätten wird durch das Atelieranmietprogramm bereitgestellt.
Ziel
des Programms ist es, Gewerbeflächen für die Nutzung als Künstlerateliers anzumieten und an
bildende Künstlerinnen und Künstler zu trag-baren Mietkosten zu vergeben.
Bewerben können sich professionelle bildende Künstlerinnen und Künstler, die
ihren ersten Wohnsitz in Berlin ha-ben und deren Einkommen den Voraussetzungen
für die Teilnahme an der sozialen Künstler-förderung entspricht. Eine zeitliche
Begrenzung für die Förderung existiert nicht.
Mit der Durchführung des Atelieranmietpro-gramms ist neben dem
Atelierbüro der Kulturwerk des BBK Berlins GmbH eine Servicegesellschaft, die
Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH (GSE), betraut. Die GSE tritt als
Generalmieterin auf und gibt die von ihr angemieteten Ateliers zu einem
reduzierten Preis von bis zu 4,09 € mtl./m²/ brutto/warm an Künstlerinnen und
Künstler weiter.
Daneben können bildende Künstlerinnen und Künstler, die nicht mehr
in der Lage sind, ihre Ateliermieten zu bezahlen, ihre Verträge auf die GSE
übertragen (sog. Vertragsüberleitungen). Die GSE wird dann Hauptmieter. Die
Laufzeit der Un-termietverträge zwischen GSE und den Künstle-rinnen und
Künstlern ist auf 2 Jahre befristet. Die Hauptmietverträge zwischen der GSE und
den Eigentümern dürfen 5 Jahre nicht überschreiten. Um Nachzahlungen aus
Nebenkostenabrechnun-gen, vertragsbedingte Leerstände und sonstige Risiken
auszugleichen, wird jährlich ein Struktur-fonds mit 51.000 € angesetzt, der zum
Jahresende abgerechnet wird. Restmittel des Programms, die im laufenden Jahr
nicht für Miete verwendet wer-den, können für kleinere Ausbaumaßnahmen ein-gesetzt
werden.
Atelieranmietprogramm
1993-2004
Kapitel 1730 / Titel 686 15 - Zuschuss an eine
Serviceeinrichtung zur Atelierbestandssicherung
|
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|||
|
|
IST / € |
IST / € |
IST / € |
IST / € |
IST / € |
IST / € |
IST / € |
IST / € |
IST / € |
IST / € |
IST / € |
Soll / € |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Personal-/Sachkosten
|
27.518,57 |
62.328,09 |
70.167,45 |
75.975,89 |
75.255,46 |
73.111,77 |
78.361,98 |
80.327,70 |
80.236,19 |
83.496,67 |
72.783,12 |
81.301,33 |
|||
|
Atelieranmietkosten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Anmietung* |
2.688,87 |
330.947,37 |
269.449,71 |
293.947,58 |
384.579,18 |
378.424,15 |
399.562,18 |
539.088,33 |
626.136,96 |
616.404,23 |
715.728,78 |
645.597,79 |
|||
|
Vertragsüberleitungen* |
1.067,96 |
212.416,66 |
369.325,68 |
499.874,83 |
519.623,67 |
562.386,21 |
421.573,32 |
373.517,67 |
370.538,85 |
324.715,96 |
310.465,41 |
290.747,13 |
|||
|
Maklergebühren |
12.291,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Mietkautionen |
10.237,91 |
84.353,55 |
15.473,87 |
11.824,47 |
33.131,79 |
20.378,95 |
40.735,09 |
24.935,18 |
563,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Strukturfonds |
7.384,95 |
5.001,46 |
50.357,59 |
35.462,27 |
28.082,39 |
39.948,05 |
67.955,15 |
19.169,82 |
20.705,99 |
23.721,52 |
59.082,97 |
51.129,19 |
|||
|
Instandhaltung/Ausfall ** |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.529,69 |
30.592,54 |
57.728,04 |
|||
|
Ausbaumaßnahmen |
25.081,75 |
28.272,51 |
0,00 |
98.307,05 |
146.494,75 |
84.377,06 |
129.862,49 |
157.842,19 |
0,00 |
43.895,69 |
0,00 |
5.000,00 |
|||
|
Gesamt Atelieranmietk. |
58.753,11 |
660.991,54 |
704.606,85 |
939.416,20 |
1.111.911,78 |
1.085.514,41 |
1.059.688,24 |
1.114.553,19 |
1.017.945,28 |
1.038.267,09 |
1.115.869,70 |
1.050.202,15 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Gesamtausgaben |
86.271,67 |
723.319,63 |
774.774,31 |
1.985,934,31 |
1.187.167,24 |
1.158.626,18 |
1.138.050,22 |
1.194.880,89 |
1.098.181,47 |
1.121.763,76 |
1.188.652,82 |
1.131.503,48 |
|||
|
Einnahmen |
811,80 |
2.246,04 |
142,76 |
0,00 |
0,00 |
44,98 |
0,00 |
8.544,15 |
25.226,91 |
4.503,36 |
13.174,33 |
4.503,48 |
|||
|
Zuwendung |
85.459,88 |
721.073,59 |
774.631,54 |
1.015.392,09 |
1.187.167,24 |
1.158.581,21 |
1.138.050,22 |
1.186.336,74 |
1.072.954,56 |
1.117.260,40 |
1.175.478,49 |
1.127.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Mietanteile der Künstler
(Ist 2000 - 2003) |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
661.002,06 |
678.174,02 |
734.646,81 |
835.459,48 |
***893.836,98 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
*
einschließlich Verwaltungspauschale. 2004 beträgt sie 111.701,26 € |
|||||||||||||||
|
** bis
2001 erhielt die GSE 10 % der Bruttowarmmiete und deckte damit auch die
Instandhaltung und Mietausfall ab. Die 10 % sind in den Positionen Anmietung
und Ver- |
|||||||||||||||
|
tragsüberleitungen enthalten. Ab 2002 erhält die GSE 6,5 % der
Bruttowarmmiete und rechnet die tatsächlich anfallenden Kosten für
Instandhaltung und Mietausfall ab. |
|||||||||||||||
|
*** Stand: Finanzierungsplan vom 10.06.2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Verfahrensbeteiligte
und ihre Aufgaben
Beteiligt an
der Durchführung des Atelieranmiet-programms sind die Senatsverwaltung für
Wissen-schaft, Forschung und Kultur, das Atelierbüro der Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins
GmbH, der
Atelierbeirat und die Gesell-schaft für
Stadtentwicklung gGmbH (GSE).
Senatsverwaltung
für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Sie steuert und
kontrolliert das Programm, ein-schließlich der damit verbundenen Verwaltungstä-tigkeiten
(u.a. Fertigung der Zuwendungen und Prü-fung der Verwendungsnachweise). Dazu
hat sie eine Steuerungsrunde mit allen Beteiligten eingerichtet, die ca. 6 Mal
im Jahr zusammenkommt.
Atelierbüro des
Kulturwerks des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH
Das Atelierbüro
fungiert im Rahmen des Atelier-anmietprogramms als Geschäftsstelle des Atelierbei-rats.
Es bereitet die Beiratssitzungen vor und doku-mentiert sie. Es schreibt die zu
vergebenden Ateliers aus und führt die Besichtigungen durch.
Im Atelierbüro
werden die Künstlerinnen und Künstler, die neu in das Atelieranmietprogramm
aufgenommen werden wollen, umfassend beraten. Mit einem Fragebogen werden die Bedürfnisse
der Interessenten und ihre Motivation für die Atelier-suche laufend erfragt.
Das Atelierbüro
nimmt die Bewerbungen entge-gen und prüft, ob die formalen Voraussetzungen
gegeben sind. Wenn eine Verlängerung der Förde-rung über 2 Jahre hinaus
beantragt wird, wird die Einkommenssituation erneut überprüft.
Der
Atelierbeauftragte hat im Rahmen des Ate-lieranmietprogramms folgende Aufgaben:
Ermittlung des
Bedarfs an Ateliers und Atelier-wohnungen, Erschließung und Realisierung von
Fördermöglichkeiten für den Bau und die Sicherung von Ateliers, Ermittlung von
Objekten, die baulich und wirtschaftlich für die Ateliernutzung geeignet sind,
Beratung von öffentlichen und privaten Bau-herren sowie Behörden, Beratung bei
der Einrich-tung von Ateliers im Rahmen der Künstlerselbst-verwaltung, Beratung
des Atelierbeirats.
Atelierbeirat
Der vom Senator
für Wissenschaft, Forschung und Kultur berufene Atelierbeirat besteht aus 10 Mitgliedern. Vorschlagsrecht für
je 1 Person ha-ben: die Akademie der Künste, die Kunst-/ Kultur-amtsleitern der
Bezirke, der Neue Berliner Kunst-verein und die Neue Gesellschaft für Bildende
Kunst. Der Berufsverband Bildender Künstler schlägt 5 Mitglieder vor. Eine sachverständige
Per-son wird vom Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur direkt benannt.
Die Mitglieder werden jeweils für 2 Jahre berufen. Die Senatsverwaltung für
Wissenschaft, Forschung und Kultur nimmt an den Sitzungen ohne Stimmrecht teil.
Der
Atelierbeirat entscheidet auf Basis der vom Atelierbüro geprüften
Fördervoraussetzungen eines Antragstellers und der eingereichten
Bewerbungsun-terlagen, welche/r Bewerber/in den Zuschlag für ein
ausgeschriebenes Atelier erhält. Künstlerinnen und Künstler, die sich in einer
finanziellen Notlage be-finden, können einen Antrag auf weitere Absenkung der
Miete stellen - auch hierüber entscheidet der Beirat. Nach Ablauf von 4 Jahren
prüft er, ob die Künstlerinnen und Künstler weiterhin ihrer Arbeit aktiv
nachgehen. In diesem Fall ist eine weitere För-derung möglich.
Gesellschaft
für Stadtentwicklung gGmbH (GSE)
Die GSE ist mit
der Verwaltung des gesamten Atelierbestandes sowie mit der Bewirtschaftung des
Atelierprogramms beauftragt. Sie begutachtet Ange-bote von Gewerbeflächen hinsichtlich
ihrer Lage und wohnungswirtschaftlichen Beschaffenheit. Sie führt die für eine
Anmietung relevanten Verhand-lungen mit den Eigentümern, schließt entsprechende
Verträge ab und sichert gegenüber den Eigentümern die vertragsgerechte
Behandlung der Mietobjekte sowie die regelmäßige Mietzahlung.
Als
Generalmieterin schließt die GSE mit den Künstlerinnen und Künstlern
Untermietverträge ab, übt ihre Vermieterrechte aus, nimmt die Mieten von den
Künstlern ein, führt Instandhaltungsaufgaben durch und betreibt das Mahn- und
Klagewesen.
Um
sicherzustellen, dass die zur Verfügung ste-henden Mittel die eingegangenen
mietvertraglichen Verpflichtungen decken, fertigt die GSE vierteljähr-lich
Finanzierungspläne und rechnet die Finanz-mittel des Programms gegenüber der
Senatsverwal-tung für Wissenschaft, Forschung und Kultur jähr-lich ab.
Schließlich
führt die GSE Baumaßnahmen zur Herrichtung von neu anzumietenden Ateliers aus
Restmitteln des Programms durch. 2004 erhält sie für ihre Leistungen ca. 81.300
€ für Personal- und Sachmittel und eine Verwaltungspauschale von 6,5 % der Bruttowarmmiete (rd. 106.000,--
€).
Entwicklung und
Ergebnisse des Atelieranmiet-programms
Bei der
Einrichtung des Programms spielte die von der Senatsverwaltung für Finanzen erhobene
Forderung nach offener Ausweisung von Subventio-nen eine maßgebliche Rolle. Für
landeseigene Im-mobilien sollen ortsübliche Mieten erhoben werden. Da bildende
Künstlerinnen und Künstler häufig nicht in der Lage sind, diese Mieten zu
zahlen, sollen die Subventionen als Zuschüsse im Landes-haushalt ausgewiesen
und aus den vorhandenen Haushaltsmitteln finanziert werden.
Von der
Einbindung einer Servicegesellschaft als Generalmieterin und der Einrichtung
des Atelierbüros als Vermittler versprach man sich folgende Vorteile:
-
Die
Belegungsbindung für die Ateliernutzungen bleibt erhalten.
-
Die
Vermieter müssen nicht überprüfen, ob es sich bei dem Mietinteressenten um
einen profes-sionellen Künstler handelt.
-
Da
die Anmietung in der Hand einer Gesell-schaft bleibt, verringert sich die
Gefahr, dass die Mietsubventionierungen zu Mieterhöhungen führen, so dass der
Effekt gemindert wird.
-
Die
Künstler müssen keine wirtschaftliche Bonität nachweisen.
Im
September 1993 startete das Programm. Künstlerinnen und Künstler, die ihre
Ateliers nicht mehr bezahlen konnten, stellten beim Atelierbüro einen Antrag
auf Überleitung ihrer Verträge. Diese Mietverträge, die mit privaten
Eigentümern oder städtischen Wohnungsbaugesellschaften abgeschlos-sen worden
waren, wurden von der GSE als Gene-ralmieter übernommen und zu vergünstigten
Mieten an die Künstlerinnen und Künstler weiter vermietet (sogenannte
„Vertragsüberleitungen“). Daraus resul-tierte, dass eine Vielzahl einzelner Ateliers,
die im gesamten Stadtgebiet verteilt waren, in das Pro-gramm aufgenommen
wurden.
Die ursprüngliche Absicht, primär bei
städtischen Wohnungsbaugesellschaften anzumieten, erwies sich nicht immer als
wirtschaftlich und zweckent-sprechend. Zum einen eigneten sich die Angebote der
Wohnungsbaugesellschaften in vielen Fällen nicht für Atelierzwecke oder hätten
mit überpropor-tional hohem Aufwand für die Ateliernutzung her-gerichtet werden
müssen; zum anderen lagen die Mietforderungen der Wohnungsbaugesellschaften
seit 1995 oft über den auf dem freien Markt zu zahlenden Mieten.
Um das Programm
konzeptionell weiter zu ent-wickeln, hat die Senatsverwaltung für Wissenschaft,
Forschung und Kultur 1995 eine Umfrage über die Atelierförderung in anderen europäischen
Städten, den Bundesländern und deutschen Städten durchge-führt. Quintessenz
war, dass die Mittel verstärkt für
Investitionen eingesetzt werden sollten. Vor diesem Hintergrund wurde u.a. die
Position des Atelierbe-auftragten im Bereich Projektentwicklung ausge-baut. Zu den Investitionen kam es jedoch nicht in dem
gewünschten Ausmaß, weil nur solche Ausbau-projekte realisiert wurden, die im
laufenden Haus-halt planungsreif und durch die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung geprüft waren. Bei vorläufiger Haushaltswirtschaft und
Haushaltssperren können neue Ausbauprojekte nicht begonnen werden.
Eine
Modifikation des Programms wurde 1997 durch eine Prüfung des
Landesrechnungshofs aus-gelöst. Er hatte festgestellt, dass 56 % der
Künstle-rinnen und Künstler Mietrückstände hatten. Die GSE, die für die
Rückstände aufkam, richtete daraufhin ein Mahnverfahren ein und vereinbarte
ggf. Ratenzahlungen. Wo keinerlei Aussicht auf Tilgung bestand, sprach sie
Kündigungen aus. Durch dieses Verfahren und eine effizientere Beratung der
Künstlerinnen und Künstler konnten seitdem die Mietrückstände auf ein Minimum
gesenkt werden.
Es
wurden keine neuen Verträge mit Miet-kautionen abgeschlossen, um Mittel nicht
langfristig zu binden.
Die
Größe der neu zu erschließenden Ateliers wurde auf maximal 70 m² festgelegt. Es
wurde be-stimmt, dass Anmietungen vor Vertragsüberleitun-gen den Vorzug
erhalten sollten.
Eingeführt
wurde schließlich auch eine Ände-rung der Risikoverteilung und Kostenstruktur
bei der Bewirtschaftung der Ateliers. Bis 2001 trug die GSE als Generalmieter
alle Risiken der Bewirtschaftung der Ateliers. Die Bewirtschaftungskosten waren
mit 10 % der Mieteingänge festgelegt. Nach Auffassung des Landesrechnungshofs
sind diese Risiken vom Auftraggeber jeweils in anfallender Höhe zu finanzieren,
so dass sie in den Finanzierungsplänen und Abrechnungen gesondert ausgewiesen
wurden. Die Verwaltungspauschale der GSE wurde danach mit 6,5 % der
Bruttowarmmiete berechnet.
Um
mehr Fördergerechtigkeit herzustellen, beschloss der Atelierbeirat am
24.10.2002, dass nach 4 Jahren neben der üblichen Einkommensüberprü-fung auch
eine Überprüfung der künstlerischen Arbeit stattfinden muss. Dabei wird
festgestellt, ob die Künstlerinnen und Künstler nach wie vor aktiv ihrer Arbeit
nachgehen und ein dringender Bedarf fortbesteht.
|
1993-2003 |
Atelierplätze
für Künstlerinnen und Künstler |
Gesamt-fläche |
Durchschnitt
der Atelierfläche |
Niedrigster
und höchster Anmietpreis mtl./ m²/ brutto/ warm |
Durchschnittlicher Anmietpreis mtl.
/ m²/ brutto/warm |
|
1993 |
6 |
521m² |
87
m² |
8,32
€ bis 12,36 € |
|
|
1994 |
79 |
5.700
m² |
72
m² |
4,90
€ bis 12,36 € |
|
|
1995 |
121 |
8.700
m² |
70
m² |
4,90
€ bis 12,90 € |
|
|
1996 |
132 |
9.500
m² |
72
m² |
4,14
€ bis 14,10 € |
|
|
1997 |
176 |
13.000
m² |
74
m² |
4,50
€ bis 12.84 € |
|
|
1998 |
203 |
13.669
m² |
66
m² |
2,99
€ bis 15,23 € |
|
|
1999 |
209 |
14.380
m² |
69
m² |
2,99
€ bis 15,36 € |
|
|
2000 |
258 |
17.096
m² |
66
m² |
2,99
€ bis 13,45 € |
6,97
€ |
|
2001 |
238 |
17.205
m² |
72
m² |
3,21
€ bis 14,56 € |
7,62
€ |
|
2002 |
274 |
18.316
m² |
67
m² |
3,05
€ bis 12,78 € |
7,16
€ |
|
2003 |
362 |
21.384
m² |
58,75
m² |
3,05
€ bis 13,33 € |
6,81
€ |
|
10.06.2004 |
365 |
21.380
m² |
55,58
m2 |
3,05
€ bis 9,25 € |
6,70
€ |
Im
Laufe der Jahre wurden 16 Objekte wegen zu hoher Mietforderungen, Eigenbedarf
der Vermieter, Restitution oder Beendigung von Vertragsüberlei-tungen
aufgegeben (Anlage 2).
Seit
1993 wurden mit Mitteln des Atelieranmiet-programms Investitionen in Höhe von
insgesamt 1.252.939,09 € zur Herrichtung von Atelierräumen getätigt. Damit
konnten 162 Ateliers mit einer Flä-che von insgesamt 10.405,42 m² geschaffen
werden. Drei Mietverträge mussten inzwischen aufgegeben werden. Für die
Ateliers am Hohenzollerndamm hat der Bezirk kürzlich Eigenbedarf angemeldet.
Darü-ber ist noch nicht abschließend entschieden. Für
4 Objekte mit 67 Ateliers sind keine
Mietsubven-tionen erforderlich (Anlage 2).
Zum
10.06.2004 waren insgesamt 69 Mietver-träge über Gewerbeflächen mit 21.380,12
m² Ate-lierläche abgeschlossen (Anlage 3). Die Ateliers wurden mit Stichtag 30.
Juni 2004 zu einem Durch-schnittsmietzins von 6,70 € mtl./m²/brutto/warm
angemietet. Die Künstlerinnen und Künstler hatten im Durchschnitt monatlich
eine Miete von 3,48 € pro m² brutto/warm zu entrichten.
Die Zahl der
Bewerbungen ist mit der Zahl der angebotenen Ateliers gestiegen. Die Bewerbungs-quoten
erreichten 1998 einen Höhepunkt.
Ateliervergaben
über den Beirat des Atelieranmietprogramms von 1993-2003
|
Jahr |
Anzahl der Atelier- vergaben |
Anzahl der Bewerbungen (ohne Alternativ- bewerbungen*) inkl. Überleitungsanträge |
Bewerber pro Jahr |
|
1993 |
95 |
175 |
151 |
|
1994 |
48 |
101 |
97 |
|
1995 |
20 |
43 |
42 |
|
1996 |
50 |
193 |
151 |
|
1997 |
41 |
105 |
95 |
|
1998 |
65 |
136 |
125 |
|
1999 |
71 |
107 |
99 |
|
2000 |
59 |
167 |
142 |
|
2001 |
45 |
128 |
113 |
|
2002 |
68 |
138 |
127 |
|
2003 |
132 |
261 |
201 |
|
Summe: |
694 |
1554 |
1343 |
* Künstler
und Künstlerinnen bewerben sich häufig in einer Vergaberunde auf mehrere
Ateliers.
Die angegebenen Zahlen
spiegeln nur die Bewerbungen auf das Atelier mit der 1. Priorität wider.
Einige Bewerber haben sich im Jahr öfter beworben.
Quelle: Atelierbüro der Kulturwerk des BBK Berlins GmbH
2004
4.3.3 Ateliers der Senatsverwaltung für
Wissen-schaft, Forschung und Kultur
Ateliers
am Käuzchensteig:
In den 60er Jahren wurden für Berliner bildende Künstlerinnen und
Künstler, die als besonders förderungswürdig galten und nicht älter als 35
Jahre waren, durch Umge-staltung des in den 30er Jahren für den Bildhauer Arno
Breker gebauten Atelierhauses Ateliers ge-schaffen. Insgesamt stehen dort 10 Ateliers mit einer Größe von 55 bis 60 m² und
einem Mietpreis von 2,56 € mtl./m²/brutto/warm zur Verfügung. Seit den 90er
Jahren erfolgt die Vergabe der Ateliers nach einem Benennungsverfahren.
Interessierte Künstle-rinnen und Künstler können sich seither bei der von der
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur berufenen
Förderkommission Bildende Kunst bewerben. Die Förderkommission entscheidet über
8 Ateliers, die für einen Zeitraum von 3 Jahren mit einer Option auf 1 weiteres
Jahr vergeben wer-den. Zwei Ateliers werden vom DAAD belegt. Das Gebäude
befindet sich im Fachvermögen der Senats-verwaltung für Wissenschaft, Forschung
und Kultur.
Atelierhaus Adlershof und
Ateliers Schneller-straße: 1994 entstanden im Haus 6 auf dem ehema-ligen Militärgelände in
Adlershof 34 Ateliers mit einer Gesamtfläche von 1.430 m² (40 m² bis 80 m²).
Ebenfalls untergebracht sind hier die Schule für Bühnenkunst, das Depot des
Keramikmuseums und das Puppentheatermuseum. 1995 wurden in der Schnellerstraße in Berlin -Treptow 6 Ateliers (33 m² bis 51
m²) hergerichtet. Für beide Objekte zahlen
die Künstlerinnen und Künstler einen
Mietzins von
2,56 € mtl./m²/brutto/warm und schließen einen Mietvertrag über 5
Jahre mit Option auf weitere 3 Jahre ab. Die Mieteinnahmen decken die
betrieb-lichen Ausgaben. Vergeben werden die Ateliers bis-her von der Fachkommission
des BBK.
Das Atelierhaus
Adlershof befindet sich im Ver-mögen des Bezirksamtes Treptow-Köpenick und ist
der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur per Verwaltungsvereinbarung
zur dauerhaften Nutzung überlassen. Die Liegenschaft Schnellerstraße befindet
sich im Fachvermögen der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und
Kultur.
Die
Senatsverwaltung für Wissenschaft, For-schung und Kultur fördert nicht nur
Ateliers in Berlin, sie stellt bildenden Künstlerinnen und Künst-lern auch
Stipendien im Ausland zur Verfügung. Zweck der Stipendien ist es, vorzugsweise
jüngeren besonders qualifizierten Künstlerinnen und Künst-lern die Schaffung
von Netzwerken in der inter-nationalen Kunstwelt zu erleichtern und bei der
Rückkehr Impulse in die hiesige Kunstszene hinein-zutragen. Die Stipendien sind
mit Ateliers in aus-ländischen Partnerinstituten verbunden, die die Kon-takte
vor Ort erleichtern. Bewerben können sich Künstlerinnen und Künstler mit abgeschlossener
Berufsausbildung. Die Entscheidung trifft eine vom zuständigen Fachreferat der
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur einberufene Jury
unabhängiger Sachverständiger, an der die ausländischen Partnerinstitute
beteiligt sind.
Insgesamt
werden 8 Auslandsstipendien im Jahr vergeben. 2003 wurden dafür 177.935 € zur
Verfü-gung gestellt (Titel 681 19, Künstlerförderung). Im einzelnen:
|
Stadt |
Zahl
der Stipendien
|
Dauer
|
Partnerinstitut
|
|
Istanbul |
2 |
6 Monate |
BM
Contemporary Art Center |
|
London |
1 |
12 Monate |
Whitechapel
Art Gallery/Delfina Studios |
|
Moskau |
1 |
3 Monate |
Moscow
House of Photography |
|
New
York |
1 |
12 Monate |
P.S.1
Contemporary Art Center |
|
Paris |
2 |
6 Monate |
Cité Internationale des
Arts |
|
Pasadena (Los Angeles) |
1 |
12 Monate |
Art
Center College of Design |
Die
Stipendien wurden seit Ende der 60er Jahre für Städte ausgeschrieben, zu denen
Berlin besonde-re Beziehungen oder Städtepartnerschaften pflegt. Das Stipendium
für Moskau wurde als letztes 1993 eingerichtet.
In
selbstständigen Kultureinrichtungen, die gele-gentlich oder institutionell
Förderung erhalten, exis-
tieren weitere
Ateliers, ebenso im Künstlerhof Buch, der gegenwärtig vom Liegenschaftsfonds
bewirt-schaftet wird (Anlage 1, 1.5). Darüber hinaus sind der Senatsverwaltung
für Wissenschaft, Forschung und Kultur weitere 550 Ateliers
von privaten Trä-gern bekannt. Nach Auskunft des Atelierbüros unter-halten
die Ausländischen Gesandtschaften und Kul-turinstitute in Berlin weitere 18
Ateliers, die über-wiegend in Kooperation mit dem Atelierbüro ein-gerichtet wurden.
Deutscher
Akademischer Austausch-Dienst e.V. (DAAD): Das Berliner
Künstlerprogramm wurde 1963 von der Ford Foundation als
„artists-in-re-sidence“-Programm begründet. 1/3 der Mittel trägt das Land
Berlin, 2/3 das Auswärtige Amt. Im Rah-men des Programms werden 15 bis 20
international bekannte Bildhauer/innen, Maler/innen, Schriftstel-ler/innen,
Komponisten und Komponistinnen aus dem Ausland für 12 Monate nach Berlin
eingeladen. 6 Stipendien werden für bildende Künstlerinnen und Künstler
vergeben. Über die Einladung entscheidet eine jährlich wechselnde
internationale Jury.
Im
Zusammenhang mit diesem Programm unter-hält der DAAD 6 Ateliers in Berlin,
davon 2 Ateliers im Künstlerhaus Bethanien und 1 Atelier im Käuzchensteig; 3
weitere Ateliers wurden auf dem freien Markt angemietet.
Künstlerhaus
Bethanien GmbH: 1973 wurde das Künstlerhaus Bethanien
als internationales Kultur-zentrum eingerichtet. Es unterhält 17 Ateliers (36
oder 72 m²) für das „Internationale Atelierpro-gramm“. Das Programm beruht auf
Abkommen mit Institutionen aus rund 15 verschiedenen Ländern. Die Stipendien
für die einjährigen Aufenthalte der Künstlerinnen und Künstler werden von den
ausländischen Partnern getragen. 2 Ateliers werden vom DAAD im Rahmen des
Künstlerprogramms angemietet und vergeben.
Kunst-Werke Berlin e.V.: 1993 wurde das Gebäu-de in
der Auguststraße 69 von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin erworben
und dem Kunst-Werke Berlin e.V. zur besitzrechtlichen Nutzung überlassen. Dazu
gehören 6 Atelierwohnungen für Künstlerinnen und Künstler, die einen Bezug zum
Programm der Kunst-Werke haben. Die Atelierwoh-nungen haben eine Größe von 43
m² bis 78 m². Die Vergabe der Atelierwohnungen erfolgt auf Vor-schlag des
künstlerischen Leiters der Kunst-Werke in Abstimmung mit der Senatsverwaltung
für Wissenschaft, Forschung und Kultur, dem Atelier-büro sowie nach Zustimmung
der Sanierungsver-waltungsstelle. Die Ateliers werden in der Regel für 1 Jahr
mit Option auf ein weiteres Jahr vergeben.
Kunsthaus Tacheles e.V.: 1990 besetzte die Künst-
lerinitiative „Tacheles“ die vom Abbruch bedrohte
Ruine in der Oranienburger Str. 54. Das Haus dient heute Kunstschaffenden aller
Sparten als Arbeits-, Begegnungs- und Kommunikationsstätte. Es verfügt über 30
Ateliers (18 bis 218 m²), die von einem unabhängigen Kuratorium für einen
Zeitraum von 6 Monaten bis zu einem
Jahr vergeben werden. Für die Ateliers müssen ausschließlich die anteiligen Betriebskosten
bezahlt werden.
Karl-Hofer-Gesellschaft: Der Freundeskreis der Universität der Künste
betreibt seit 1997 in Ober-schöneweide eine Etage mit 14 Ateliers sowie eine
Galerie. Für 12 Ateliers können sich Meisterschüle-rinnen und Meisterschüler
der letzten 5 Jahre bewer-ben. Für die auf 2 Jahre begrenzte Nutzung ist ein
Unkostenbeitrag von 50 € im Monat zu zahlen. 2 Atelierwohnungen werden an internationale Künstlerinnen
und Künstler für 2 Jahre vergeben. Der Mietpreis wird frei verhandelt (280 €
bis 350 € mtl.). Eine von der Karl-Hofer-Gesellschaft einberufene Jury
entscheidet über die Ateliersti-pendien.
Künstlerhof
Buch: Auf dem Gelände befinden sich 13 Ateliers und 10
Freiarbeitsflächen für Bildhauer sowie eine Metallwerkstatt, eine Formerei und
eine Holzwerkstatt. 8 Ateliers und 6 Freiflächen wurden durch die
Fachkommission des BBK zu einem Mietzins von 2,56 € mtl./m²/brutto/warm
vergeben. Dieser Betrag war nicht kostendeckend. Die rest-lichen Ateliers
wurden durch die Akademie der Künste belegt. Nachdem sich die Akademie, die das
Gelände 1995 übernommen hatte, nicht mehr in der Lage sah, den Künstlerhof bei
gleichbleibender Zuwendung zu bewirtschaften, wurde das Gelände dem
Liegenschaftsfonds gegeben, der die Ateliers zur Zeit verwaltet.
Atelierförderung ist in der
Regel Angelegen- heit der Kommunen. Von
den Flächenstaaten fördert nur noch der Freistaat Bayern Künstlerar-
beitsstätten. Seit 2003 betreibt er ein eigenes Künstlerhaus, für das u.a. 4
bildende Künstlerinnen und Künstler ein Stipendium erhalten. Für das
inter-nationale Künstlerhaus „Villa Concordia“ sind Mit-tel i.H.v. 887.600 €
etatisiert.
Daneben besteht
das bayerische Atelierförder-programm: Bis zu 150 bayerische Künstler erhalten
für die Dauer von drei Jahren einen monatlichen Zuschuss zu ihren Atelierkosten
in Höhe von mo-natlich 155 €. Für die Atelierförderung stehen jähr-lich 279.000
€ zur Verfügung. Die Zuschüsse wer-den für angemietete, anzumietende oder
selbst erstellte bzw. gekaufte Ateliers mit noch nicht abge-schlossener
Finanzierung gewährt. Bewerben kön-nen sich professionelle freischaffende
Künstlerinnen und Künstler aus Bayern.
In
Niedersachsen ist die Atelierförderung 2001 eingestellt worden. 1991 -
2000 wurden rund 1 Mio. € für den Ausbau von Künstlerateliers zur Verfü-gung
gestellt. Insgesamt wurden 101 Ateliers mit bis zu je 20 TDM gefördert (bei
Großprojekten auch mehr). 6 private Atelierhäuser, die bezuschusst wur-den,
existieren heute noch. Empfehlungen für eine Förderung sprach die
Niedersächsische Kunstkom-mission aus.
In Deutschland wurden Städte
mit über 500.000 Einwohnern über die Ateliersituation befragt. Geant-wortet
haben 10 Städte, davon haben 3 Städte keine Atelierförderung (ausführliche
Darstellung s. Anlage 4).
Daten
über die Ateliersituation auf dem Immobi-lienmarkt stehen nicht zur Verfügung.
Deshalb kön-nen in der folgenden Übersicht keine Aussagen darüber gemacht
werden, wie leicht Künstlerinnen und Künstler ein Atelier finden. Gezeigt
werden kann nur, in welchem Ausmaß Künstlerinnen und Künstler strukturell
gesicherte Ateliers bekommen können. Bremen schneidet z.B. bei der Zahl der
Künstlerinnen und Künstler, die auf ein gesichertes Atelier entfallen,
besonders schlecht ab, weil die dortige Stadtverwaltung die Ateliersituation
für un-problematisch hält und Künstlerförderung auf andere Maßnahmen
konzentriert, bei denen Bremen unter den Städten eine Spitzenposition einnimmt.
Folgende Tabellen des
Städtevergleichs geben einen Überblick über die Atelierförderung und
Strukturdaten. Da es keine einheitlichen statis-tischen Erhebungen gibt, ist es
problematisch, Vergleiche anzustellen.
Städtevergleich –
Strukturdaten
|
|
Zahl der Künstler/ Künstlerinnen |
Zahl der strukturell gesicherten Ateliers |
Zahl der Künstler/Künstlerinnen auf
ein strukturell gesichertes Atelier |
Mietkosten der Künstler/Künstlerinnen teilw. geschätzt brutto/warm |
|
Berlin |
5.000 |
859 |
5,8 |
2,56
€ - 11,60 € |
|
Bremen |
400 |
16 |
25,0 |
3,25 € |
|
Düsseldorf |
1.800 |
250 |
7,2 |
3,57
€ -
5,01 € |
|
Duisburg |
250 |
70 |
3,6 |
2,00 € |
|
Hamburg |
3.000 |
70 |
42,9 |
4,50
€ -
7,50 € |
|
Köln |
2.000 |
123 |
16,2 |
2,80 € - 6,20 € |
|
Leipzig |
500 |
44 |
11,4 |
3,00 € |
|
München |
3.000 |
220 |
13,6 |
7,50 € |
|
Stuttgart |
1.500 |
78 |
19,2 |
2,50 € -
5,00 € |
Städtevergleich –
Atelierförderung
|
|
Ateliers in städtischen
Atelier-/ Künstlerhäusern |
Angemietete Ateliers (ohne Verwaltungsaufwand) |
Ausbaumittel an Künstler |
Mietzuschüsse an Künstler |
|||
|
|
Zahl |
Finanzierung 2004 |
Zahl |
Finanzierung 2004 |
2004 |
Zahl |
Finanzierung 2004 |
Berlin
|
50 |
* |
365 |
824.644 € |
./. |
./. |
./. |
|
Bremen |
16 |
30.000 € |
./. |
./. |
(Darlehen) 60.000 € |
./. |
./. |
|
Düsseldorf |
140 |
160.000 € |
30 |
40.000 € |
42.500 € |
./. |
./. |
|
Duisburg |
70 |
34.500 € |
./. |
./. |
./. |
./. |
./. |
|
Hamburg |
19 |
(Bau einmalig) 51.000 € |
./. |
./. |
25.000 € |
./. |
./. |
|
Köln |
108 |
17.300 € |
40 |
50.000 € |
51.000 € |
./. |
./. |
|
Leipzig |
./. |
./. |
44 |
66.000 € |
./. |
./. |
./. |
|
München |
50 |
120.000 € |
./. |
./. |
./. |
130 |
120.000 € |
|
Stuttgart |
78 |
128.000 € |
./. |
./. |
zuletzt 2002/03 |
./. |
./. |
·
Die Bauunterhaltung erfolgt über die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Die Mieteinnahmen decken die Betriebskosten.
Verwaltung erfolgt durch SenWissKult.
Grundsätzlich
gibt es in Deutschland vier unter-schiedliche Wege, Ateliers zu fördern:
1.
Mietzuschüsse werden direkt an Künstlerinnen und
Künstler gegeben (München).
2.
Künstlerinnen und Künstler können Zuschüsse zum
Ausbau von Räumen beantragen (Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Köln).
3.
Die Städte unterhalten selbst Atelier- oder
Künstlerhäuser (Berlin, Bremen, Düsseldorf, Duisburg, Hamburg, Köln, München,
Stuttgart).
4.
Es werden Ateliers von der Stadt oder einem
Dienstleister angemietet (Berlin, Düsseldorf, Köln, Leipzig).
Der öffentlich
finanzierte Ausbau von privaten Gebäuden ohne Belegungsbindung für Ateliers ist
inzwischen überall eingestellt worden.
Die Vergabe der
Fördermittel an die Künstlerin-nen und Künstler hat den Vorzug, dass der Weg
zum Empfänger kurz und der Verwaltungsaufwand ge-ring ist. Künstlerinnen und
Künstler in München können zwei Mal bis zu 3 Jahren eine Förderung ihres
Ateliers in Höhe von bis zu 153,39 € im Monat erhalten. Ziel dieses Programms
ist es, bildende Künstlerinnen und Künstler zu motivieren, selbst
Atelierflächen zu schaffen, weil es im innerstädti-schen Bereich anders als in
Industriestädten einen Mangel an Gewerberäumen gibt. Eine zentrale Si-cherung
des Atelierbestandes erfolgt auf diese Weise nicht. Bei Ausbauzuschüssen, die
direkt an die Künstler vergeben werden, wird meist die Vorlage eines mindestens
fünfjährigen Mietvertrags verlangt.
Im
Städtevergleich erscheinen Mietzuschüsse für Künstlerinnen und Künstler und der
Betrieb städtischer Atelierhäuser am kostengünstigsten. Die Vergleichbarkeit
der Zahlen dürfte jedoch insofern eingeschränkt sein, als die
Investitionskosten für die städtischen Atelierhäuser vermutlich in der Regel
ebenso wenig in vollem Umfang berücksichtigt wurden wie der Verwaltungsaufwand.
Vergleicht man lediglich die
Höhe der Mietzu-schüsse bzw. Mietsubvention im Jahr 2004 in den verschiedenen
Städten, so ergibt sich: München ge-währt Mietzuschüsse in Höhe von 923 € pro
Künst-ler/in im Jahr. In Leipzig werden angemietete Flä-chen mit 1.500 € pro
Atelier im Jahr subventioniert, in Düsseldorf mit 1.333 €, in Köln mit 1.250 €.
Berlin zahlt jährliche Mietsubventionen von durch-schnittlich 2.259 € pro
Atelier. Außerdem
entstehen in Berlin 2004 weitere Nebenkosten (Instandhaltung, Mietausfall,
Ausbau etc.) in Höhe von durchschnitt-lich 312 € pro Atelier ohne
Verwaltungskosten. Da-bei ist zu berücksichtigen, dass die Mieten auf dem
Immobilienmarkt in München, Düsseldorf und Köln höher sein dürften als in
Berlin. Aus diesem Blickwinkel ist das Berliner Atelieranmietprogramm also
vergleichsweise teuer, was sich mit Ausnahme von München nicht in den
Mietpreisen nieder-schlägt, die von den Künstlern zu entrichten sind.
Die Vergabekriterien für
geförderte Ateliers sind in vielen Städten ähnlich. Berücksichtigt werden
überall ausschließlich Berufskünstlerinnen und -künstler. In München entscheidet die künstlerische
Qualität. In Düsseldorf sind künstlerische Qualität, der Bezug zu Düsseldorf,
eine akademische Ausbil-dung und die Dringlichkeit Auswahlkriterien. In Köln
wird nach künstlerischer Qualität, beruflicher Dringlichkeit und sozialer
Bedürftigkeit entschieden. Für die Teilnahme am Atelieranmietprogramm in Berlin
ist Voraussetzung, dass die Künstler hier ihren ersten Wohnsitz haben,
professionell arbeiten und die Kriterien für die soziale Künstlerförderung
erfüllen. Stuttgart und Leipzig vergeben Ateliers auf Grundlage einer
Warteliste.
Die
Vergabeentscheidung erfolgt in Düsseldorf durch das Kulturamt und in Leipzig
durch den Beigeordneten für Kultur, der sich im Konfliktfall mit dem Bund
Bildender Künstler in Leipzig abstimmt. In den anderen Städten entscheiden
Jurys, deren Mitglieder berufen oder nach dem Delega-tionsprinzip
zusammengesetzt sind: Der Fachbeirat in Hamburg besteht aus 4 Künstler/innen
und 3 Ver-treter/innen der Fachöffentlichkeit, die vom Verein „Ateliers für die
Kunst“ gewählt werden. In Duis-burg entscheidet die Interessengemeinschaft Duis-burger
Künstler zusammen mit der Stiftung Lehm-bruck Museum. In Köln und Stuttgart
werden Fach-jurys vom Kulturamt berufen. Das Kölner Gremium setzt sich aus
Künstlern, Kunstvermittlern, Kunst-kritikern, Vertretern des BBK und Vertretern
des Kulturamts zusammen.
In
Stuttgart besteht die Jury aus 5 sachverstän-digen Persönlichkeiten: Davon
werden 2 von den örtlichen Künstlerverbänden (Verband bildender Künstlerinnen
und Künstler Württemberg, GEDOK) vorgeschlagen, eine vom Württembergischen
Kunst-verein und eine von der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste. Den
Vorsitz führt das Kulturamt, in der Regel vertreten durch den Referenten für
bil-dende Kunst. In München beruft der Kulturaus-schuss des Stadtrates die
Jury. Sie besteht aus der Kulturreferentin, Vorstandsmitgliedern der Künstler-verbände,
dem Galeristenverband, einem Kunst-kritiker, dem/der amtierende/n
Kunstpreisträger/in und den Kultursprecher/innen der 3 Stadtratsfrakti-onen. In
Berlin existieren 2 Gremien, der Atelier-beirat und die Fachkommission (s.
Punkt 4.2 und 4.3.1).
Europäische
Städte
Neben
den deutschen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern wurden 10 europäische
Städte gebeten, Auskunft über ihre Ateliersituation und Atelierförderung zu
geben. Madrid hat mitgeteilt, dass es keine Atelierförderung gibt. In Brüssel
existiert eine gemeinnützige Organisation, die preis-günstige
Zwischennutzungen ermöglicht. In Ant-werpen wird an einem Konzept für
die Atelier-förderung gearbeitet. In Wien werden Atelierwoh-nungen im
Rahmen des städtischen Wohnungsbau-bestandes vergeben. Das Bundeskanzleramt
verfügt außerdem über Ateliers in Wien, die für jeweils 4 Jahre kostenlos durch
eine Jury vergeben werden (ausführliche Informationen s. Anlage 5).
In
London stellen drei von Künstlern gegründete gemeinnützige
Organisationen ca. 1.500 Ateliers zur Verfügung. Bei der Vergabe werden nicht
nur bil-dende Künstler berücksichtigt. Den sehr hohen Miet-preisen in London
geschuldet beträgt die durch-schnittliche Ateliergröße nur 28 - 30 m². Die
Künstlerinnen und Künstler zahlen Mieten von 10,40 - ca. 13,00 € mtl./m²/warm.
Diese vergleichs-weise günstigen Mieten werden durch Investitions-zuschüsse und
durch mäzenatische Mietpreise er-zielt. In London wird Atelierförderung mit
künst-lerischen Werkstätten, Weiterbildungsangeboten und mit einer Vermittlung
von kunstnahen Jobs ver-bunden.
In
Paris hat die Atelierförderung eine lange Tradition. Das städtische
Kulturdezernat vergibt 1.000 Ateliers an bildende Künstlerinnen und Künst-ler,
DRAC Ile de France, eine staatliche Organisa-tion des Kulturministeriums,
verwaltet weitere 464 Ateliers in Paris und 448 am Stadtrand. Es handelt sich
meistens um Atelierwohnungen im sozialen Wohnungsbau mit unbegrenzter
Nutzungsdauer. Die bildenden Künstlerinnen und Künstler zahlen 7,00 - 9,00 €
mtl./m²/brutto/warm. Paris plant weitere 3.000 Ateliers im Innenstadtbereich,
die ohne Wohnanteil zeitlich begrenzt vergeben werden sollen.
In
Amsterdam sind gemeinnützige Organisatio-nen für die Atelierförderung
zuständig. Die wich-tigste, Broedplaats (deutsch: Brutstätte), verfügt über
1.000 Ateliers, Atelierwohnungen und Gebäude für Künstlergruppen. Die Ateliers
werden durchschnitt-lich für 5 Jahre angemietet und von der Kommune,
Wohnungsgesellschaften oder den Künstlern selbst verwaltet. Weitere
Organisationen stellen rund 200 Ateliers bereit.
|
|
Zahl der Künstler/ Künstlerinnen |
Zahl der strukturell verfügbaren
Ateliers |
Mietkosten der Künst-ler/Künstlerinnen teilw. geschätzt brutto/warm |
durchschnittliche
Ateliergröße |
Berlin
|
4.000
- 5.000 |
859 |
2,56 - 11,60 € |
60 m² * |
|
London |
20.000 |
1.500 |
10,40 -
13,00 € |
28-30 m² |
|
Paris |
9.000
- 10.000 |
1.912 |
7,00
- 9,00 € |
40-50
m² |
|
Amsterdam |
10.000 |
1.200 |
4,17 € |
30-50 m² |
·
Die Zahl der Künstler ist geschätzt. Die Angabe
der durchschnittlichen Ateliergröße in Berlin beruht auf dem
Atelieranmietprogramm. Die Größen der Atelierwohnungen ist nur sehr schwer zu
ermitteln. Einheitliche Kriterien für die Definition eines bildenden Künstlers
gibt es in Europa nicht.
Geförderte
Atelierwohnungen werden in allen Städten unbefristet vermietet. Bei der Vermietung
von Gewerbeflächen ist die Praxis unterschiedlich. In Paris, London, Stuttgart
und Düsseldorf wird die geringe Fluktuation in geförderten Ateliers als
Schwäche angesehen. Junge Künstlerinnen und Künstler haben zu geringe Chancen,
ein günstiges Atelier zu bekommen.
Der Ausschuss
für Kulturelle Angelegenheiten des Abgeordnetenhauses hat in seiner 43. Sitzung
am 24. Mai 2004 einvernehmlich folgende Empfeh-lung an den Hauptausschuss beschlossen
(Inhalts-protokoll 15/43):
1.
Der
Ausschuss für Kulturelle Angelegenheiten nimmt die roten Nummern Haupt 2457 und
2457 A zur Kenntnis.
2.
Der
Ausschuss für Kulturelle Angelegenheiten spricht sich für den Erhalt und die weitere
Qualifizierung auch unter den Prämissen einer möglichen Effektivierung des Ateliersofortpro-gramms
aus.
3.
Der
Ausschuss für Kulturelle Angelegenheiten spricht sich für die Prüfung aller Möglichkeiten
des Ausbaus des Ateliersofortprogramms unter Einbeziehung der Angebote der
städtischen Wohnungsbaugesellschaften, des Liegenschafts-fonds und anderer
möglicher landeseigener Im-mobilien aus.
Vorteil
der Atelierförderung als Anmietung von Künstlerarbeitsstätten durch einen
Generalmieter ist die große Flexibilität. Das betrifft die Mietpreis-gestaltung
für die Künstlerinnen und Künstler eben-so wie die angemieteten Objekte: Sinken
die Miet-preise, kann schnell reagiert werden. Ein General-mieter kann
günstigere Mietkonditionen erreichen als einzelne Künstler, die außerdem vom
Vermieter geforderte Sicherheiten in den meisten Fällen nicht bieten können.
Ein Generalmieter bietet Gewähr dafür, dass der Bestand an Ateliers gesichert
wird. Die angemieteten Räume sind sofort nutzbar. Auch kleinere Einheiten
können gefördert und individuelle Bedürfnisse von Künstlerinnen und Künstlern
berücksichtigt werden.
Die
Entwicklung der Ergebnisse des Atelieran-mietprogramms zeigt die Vorteile:
1.
In den Jahren 1993 - 1995, als die Mieten
exorbitante Höhen erreichten, hat das Programm einem dauerhaften Verlust von
Künstlerarbeits-stätten entgegengewirkt und dafür gesorgt, dass den
Künstlerinnen und Künstlern, die sich seinerzeit in einer besonders prekären
Lage befanden, kurzfristig bezahlbare Ateliers zur Verfügung gestellt werden
konnten.
2.
Der
Bestand an strukturell gesicherten Ateliers wurde von 1995 bis heute mit
beachtlichen jährlichen Zuwachsraten erhöht. Gleichzeitig gelang es, die Mietpreise
dabei an den unteren Rand der (sinkenden) Vergleichsmieten zu bringen.
3.
Der Bestand an Ateliers wurde qualitativ
konti-nuierlich verbessert.
Den
Vorteilen steht als Nachteil die Konjunktur-abhängigkeit des Programms
gegenüber. Steigende Mietpreise führen automatisch dazu, dass der Bestand an
Ateliers abnimmt. Sinkende Fördermittel vermindern ebenfalls sofort den
Atelierbestand. Das Programm hat keine nachhaltige Wirkung.
Bedeutender
Nachteil ist, dass das Atelieranmiet-programm finanziell aufwendig ist. Die Anmietung durch einen Generalmieter ist mit
erhöhten Personal- und Sachkosten verbunden: Fortlaufend müssen neue Ateliers
akquiriert, besichtigt, bewertet und angemietet werden, immer wieder sind
Verhand-lungen mit Eigentümern zu führen und entsprechen-de Verträge
abzuschließen - schon allein dadurch ergeben sich höhere Kosten für die
Verwaltung der Ateliers als dies zum Beispiel bei städtischen Atelierhäusern
der Fall ist. Ein Kostenvergleich mit der Atelierförderung in anderen Städten
weist tendenziell in die gleiche Richtung, ist allerdings, wie bereits
dargelegt, in seiner Aussagekraft einge-schränkt, weil nicht überall dieselben
Kostenarten erfasst werden. Fest steht: Die reine Mietsubvention beträgt durchschnittlich
pro Atelier 2.259 € im Jahr (Stichtag 10. Juni 2004); einschließlich Nebenkosten
wie Instandhaltung, Mietausfall etc. sind es ohne Verwaltungskosten 2.571 € pro
Atelier. Die höchste Förderung für eine/n Künstler/in liegt über 9.000 € im
Jahr und ist somit fast einem Arbeitsstipendium der Senatsverwaltung für
Wissenschaft, Forschung und Kultur für bildende Künstlerinnen und Künstler
vergleichbar, das mit 11.500 € - allerdings einmalig - dotiert ist. Im
günstigsten Fall (Heynstraße) ist eine Förderung gar nicht notwendig, weil der
Anmiet-preis entsprechend niedrig ist, bzw. es werden sogar geringfügige
Einnahmen von der Generalmieterin gemacht.
Mit
dem Auslaufen ungünstiger Mietverträge sollen deshalb zukünftig bis zu 50 % der
Förder-mittel eingesetzt werden, um auf Grundlage der vom Abgeordnetenhaus
beschlossenen Regelungen über die Zwischennutzung leerstehender landeseigener
Liegenschaften für Atelierzwecke herzurichten. Für einen wirtschaftlichen
Einsatz von Investitionsmit-teln ist die Möglichkeit der Übertragbarkeit der
Mittel zu prüfen.
Derzeit werden
54 % der Ateliers im Atelieran-mietprogramm zu einem Mietzins von 4,09 € mtl./
m²/brutto/warm an die Künstlerinnen und Künstler weitergegeben. 46 % der
Künstler zahlen zwischen 2 € und 4 €
m²/brutto/warm aufgrund verschiedener Aspekte (u.a. Heizkostenanteil wird
selbst getragen, ggf. mindere Ausstattung, soziale Gründe). Nach Aussage der
GSE sind viele der Künstler nicht mehr in der Lage, den Betrag von 4,09 € aufzubringen.
Rund 19 % (68) der Künstler im Atelieranmiet-programm haben auf Antrag beim
Atelierbeirat eine individuelle Sonderregelung, d.h. eine weitere Ab-senkung
der Miete aus sozialen Gründen vereinbart.
|
Mietzins/m² |
bis 2,00 € |
2,00 - 2,40 € |
2,50 - 2,90 € |
3,00 - 3,40 € |
3,59 - 4,00 € |
4,09 € |
|
Anteil der Künstler/innen |
1% |
2% |
10% |
25% |
8% |
54% |
Erhebung vom
07.04.2004 für den Zeitraum: per März
2004
Die
GSE schlägt wegen der hohen Zahl dieser Sonderregelungen vor, die Mieten
generell auf 3,30 - 3,50 € abzusenken. Dieser Empfehlung will der Senat nicht
folgen, weil ein Teil der Künstlerinnen und Künstler in der Lage ist, die
bisherige Miete in Höhe von 4,09 € aufzubringen. Die Durchschnitts-miete, die
Künstlerinnen und Künstler bezahlen, liegt bei 3,48 €. Eine denkbare
Alternative wäre ein Kontingent von besonders preisgünstigen Ateliers für
Künstler mit sehr niedrigem Einkommen, insbesondere für ältere Künstlerinnen
und Künstler. Für Berufsanfänger, die noch nicht über ein umfang-reiches Oeuvre
verfügen, ist die Zwischennutzung von leerstehenden Gewerberäumen bei der
derzeiti-gen Marktsituation eine gute Alternative.
Vergabekriterien
Kriterien
für die Vergabe von Ateliers im Ate-lieranmietprogramm sind Professionalität,
Dring-lichkeit und die Erfüllung der Voraussetzungen für die soziale
Künstlerförderung. Professionalität und Dringlichkeit werden vom Atelierbeirat
geprüft, die sozialen Voraussetzungen vom Atelierbüro. Aus Gründen der
Praktikabilität wurden bei der Einrich-tung des Atelieranmietprogramms
dieselben Krite-rien wie für die soziale Künstlerförderung von 1993 zugrunde gelegt.
Die Einkommensgrenzen sollen zukünftig von der sozialen Künstlerförderung
abge-koppelt werden, weil diese Einkommensgrenzen zu hoch sind: Nach den 1996
festgelegten Einkom-mensgrenzen erfüllt z.B. ein lediger Künstler mit einem
Jahreseinkommen von bis zu brutto 22.640 € im Jahr die Voraussetzungen für die
soziale Künstlerförderung. Es dürfte nur wenige Künstle-rinnen und Künstler
geben, die mehr verdienen. Die Angaben beruhen auf einer Selbstauskunft. In
Zweifelsfällen kann eine Steuererklärung verlangt werden. Diese Regelung ist
ohne großen Verwal-tungsaufwand zu handhaben. Der Missbrauch dürfte sich in
Grenzen halten, zumal durch die Zusammen-setzung des Atelierbeirats eine breite
Personenkennt-nis der Bewerber vorhanden ist, die durchaus Ein-schätzungen der
individuellen sozialen Situation ermöglichen.
Förderdauer
der Künstlerinnen und Künstler
Die Verträge,
die der Generalmieter mit den Künstlerinnen und Künstlern abschließt, sind auf
zwei Jahre befristet. Nach zwei Jahren wird die so-ziale Bedürftigkeit
überprüft. Nach vier Jahren prüft der Atelierbeirat erneut, ob die
Fördervoraussetzun-gen noch vorliegen. Grundsätzlich existiert derzeit keine
zeitliche Begrenzung für die Förderung. Mehr als 50 % der Künstlerinnen und
Künstler nutzen das Programm weniger als 4 Jahre, rund 10 % nutzen es 8 Jahre
und länger.
Dauer
der Atelierförderung im Anmietprogramm
|
Jahre |
bis 1 |
bis 2 |
bis 3 |
bis 4 |
bis 5 |
bis 6 |
bis 7 |
bis 8 |
bis 9 |
bis 10 |
bis 11 |
gesamt |
|
Künst-ler/innen |
118 |
68 |
48 |
57 |
54 |
50 |
29 |
17 |
18 |
23 |
12 |
494 |
Erhebung vom 07.04.2004 für den
Zeitraum: 1993 bis 31.03.2004
Um mehr
Fördergerechtigkeit zu erreichen und eine größere Anzahl von Künstlerinnen und
Künst-lern die Arbeit in einem geförderten Atelier zu er-möglichen, sollen die
Mietverträge der Künstlerin-nen und Künstler auf eine Dauer von 4 Jahren plus 4
Jahre Option begrenzt werden.
Zwischen
zeitlich befristet und unbefristet nutz-baren Ateliers soll in Zukunft klarer
unterschieden werden. Beides wird benötigt. Für das Atelieran-mietprogramm
erscheint eine Nutzungsdauer von maximal 8 Jahren ausreichend.
Für
die Entscheidung über die Vergabe von Ate-liers gibt es zwei Gremien, den Atelierbeirat
und die Fachkommission des BBK.
Der
Atelierbeirat entscheidet über die Bewerbun-gen für das Atelieranmietprogramm,
die Fachkom-mission über die Ateliers, die durch Programme der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung gefördert wurden und deren Vergabe zeitlich nicht
befristet erfolgt sowie über andere Ateliers außerhalb des
Atelieranmietprogramms, für die Belegrechte vor-handen sind. Sie entscheidet
außerdem bisher über die Ateliers im Fachvermögen der Senatsverwaltung für
Wissenschaft, Forschung und Kultur in Adlers-hof und in der Schnellerstraße.
Der
Atelierbeirat wird vom Senator für Wissen-schaft, Forschung und Kultur berufen,
die Mitglieder der Fachkommission von der Mitgliederversamm-lung des BBK
gewählt. Beide Gremien arbeiten auf der Grundlage einer Geschäftsordnung und
tagen ca. sechs Mal im Jahr. Mitglieder des Atelierbeirats er-halten, soweit
sie freiberufliche bildende Künstler sind, eine Aufwandsentschädigung von 26 €
pro Sit-zung. Die Mitglieder der Fachkommission arbeiten ehrenamtlich. Bei den
Sitzungen des Atelierbeirats sind die Senatsverwaltung für Wissenschaft,
For-schung und Kultur und die GSE anwesend. Zu Sitzungen der Fachkommission
sollen Vertreter der Bezirke eingeladen werden, wenn es um Ateliers geht, die
für die Infrastruktur von Bedeutung sind. Die Senatsverwaltung für
Wissenschaft, Forschung und Kultur ist nicht beteiligt.
Als Grund für die Existenz
von zwei Entschei-dungsgremien wurde vom Atelierbeirat und vom Vorstand des BBK
angeführt, dass die Arbeit für ein Gremium zu viel sei und dass die Konzentration
auf ein Gremium zu Ungerechtigkeiten gegenüber den Künstlern führen
könnte, weil Entscheidungen immer auch subjektiv seien. Historisch ist die
Fachkommission des BBK zuerst eingerichtet worden. Sie sollte kulturpolitisch
im Sinne der Künstlerinnen und Künstler wirken und Belegrechte für die durch
die Senatsverwaltung für Stadtent-wicklung geförderten Ateliers und
Atelierwohnun-gen wahrnehmen. Die Vergabe von Ateliers aus dem Fachvermögen der
Senatsverwaltung für Wissen-schaft, Forschung und Kultur wurde ebenfalls der
Fachkommission übertragen, weil es zu diesem Zeitpunkt den Atelierbeirat noch
nicht gab.
Der Atelierbeirat arbeitet
verantwortungsvoll und sehr sorgfältig. Die Zusammensetzung hat sich im Großen
und Ganzen bewährt. Allerdings muss in Zukunft ausgeschlossen werden, dass
Künstler, de-ren Ateliers im Atelieranmietprogramm gefördert werden, Mitglied
des Beirats sind. Darauf sind der BBK-Vorstand und der Geschäftsführer des
Kultur-werks hingewiesen worden. Bei der Vertretung der Kunst- und
Kulturamtsleiterinnen der Bezirke funktioniert der intendierte
Informationstransfer bis-her nicht. Mit den Bezirken wurde inzwischen besprochen,
dass sie, wenn sie dies wünschen, vor der Sitzung über Atelierangebote informiert
werden, an der Sitzung teilnehmen können und das Sitzungs-protokoll erhalten.
Auch bei Immobilien, die in den Bezirken als Atelierstandorte entwickelt
werden, wollen die Kunst- und Kulturämter neben anderen bezirklichen
Dienststellen verstärkt mitwirken.
Zur
Beurteilung der Qualität der Arbeit der Fach-kommission kann seitens der
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur aus eigener Anschauung
nichts beigetragen werden. Es gibt jedoch keinen Anlass, an der Kompetenz zu
zwei-feln. Unabhängig davon ist die mangelhafte Einbin-dung der
Senatsverwaltung und der Bezirke äußerst problematisch, auch unter dem
Gesichtspunkt, dass die Belegungsbindungen der von der Senatsverwal-tung für
Stadtentwicklung geförderten Ateliers aus-laufen und Perspektiven für eine
strukturelle Siche-rung von Ateliers insgesamt entwickelt werden müssen.
Die unterschiedliche
Struktur der Gremien ist aus heutiger Sicht nicht sinnvoll. Um Transparenz und
Informationsfluss zu gewährleisten erscheint ein Gremium sachgerechter. Ob aus arbeitsorganisatori-schen Gründen Unterkommissionen
erforderlich sind, muss in der Praxis erprobt werden.
Um die im
Atelieranmietprogramm angemieteten Künstlerarbeitsstätten zu sichern, wurde die
Gesell-schaft für Stadtentwicklung des SPI (GSE) als Generalmieter und
Verwalter beauftragt.
Die
Leistungsbilanz für 2002/2003 zeigt: 2002 2003
Atelierbestandsentwicklung
Hauptmietverträge 66 64
Untermietverträge 254 336
Atelierneuvergaben 37 88
Vertragsentwicklungen Künstler
(neue Verträge/Vertragsänderungen/Sollkorrekturen) 206 249
Vertragsentwicklungen Eigentümer
(neue
Verträge/Vertragsänderungen/Sollkorrekturen) 156 122
Betriebskostenabrechnungen 86 70
Rückgaben an Eigentümer (Termine) 8 9
Rückgaben / Künstler:
Mahnungen 241 336
Ratenzahlungsvereinbarungen 40 38
Kündigungen 19 18
Gerichtsverfahren
(Räumungsklagen) 13 8
Besichtigungen
(Angebote, neue Ateliers, Bestand) 50 64
Sitzungen (Atelierbeirat, Abstimmungsrunden) 39 36
Finanzpläne (Planung/Umsetzung) 6 6
laufende Vertragsbuchungen 3.840 4.800
Buchung laufender Geschäftsvorfälle 540 720
Ob
die Leistungen auf dem Markt auch günstiger zu haben sind, wurde bisher nicht geprüft.
Bei der Einrichtung des Atelieranmietprogramms wurde auf eine Ausschreibung
verzichtet, weil in der Phase der Programmentwicklung ein Träger gesucht wurde,
der Erfahrung mit besonderen Bedarfsgruppen des Wohnungsmarkts hatte.
Die Senatsverwaltung für
Wissenschaft, For-schung und Kultur beabsichtigt, ein Interessen- bekundungsverfahren durchzuführen, wobei
die Schnittstellen für die Künstlerbetreuung neu zu definieren sind.
Komplementär zur GSE wurde
für die Beratung der Künstler, die Betreuung der Auswahlgremien, die
Erschließung neuer Ateliers einschl. Konzeptent-wicklung das Atelierbüro
beim Kulturwerk des BBK (aus dem Titel 685 69) mit folgenden Stellen
finanziert:
·
Atelierbeauftragter (30 Wochenstunden):
Grundsatz, Entwicklung von
Konzepten, Bera-tung, Öffentlichkeitsarbeit, Akquise und Reali-sierung von
Atelierprojekten, Bedarfsermittlung und Statistik, Leitung der Geschäftsstelle
unab-hängiger Vergabebeiräte, Sicherung des Atelier-bestandes, internationale
Kontakte (Anteil Ate-lieranmietprogramm ca. 20 %)
·
Referent für Strategie- und Konzeptentwicklung (8,5 Wochenstunden) (Anteil
Atelieranmietpro-gramm ca. 50 %)
·
Sachbearbeitung Atelieranmietprogramm (38,5 Wochenstunden): Künstlerberatung,
Geschäfts-stelle, Ausschreibung der Angebote, Bestands-pflege, Service
"freie Angebote", Öffentlich-keitsarbeit/Sonderprojekte, Datenbankentwick-lung,
Zusammenarbeit mit Bezirken, Quartiers-management, freie Atelierhäuser,
Eigentümer, Investoren (Anteil Atelieranmietprogramm ca. 50 %)
·
Sachbearbeitung Fachkommission/ModInst
(38,5 Wochenstunden):
Künstlerberatung, Ge-schäftsstelle, Ausschreibung der Angebote,
Pro-grammentwicklung, Programmbewirtschaftung/ Bestandspflege, Service
"freie Angebote", Öf-fentlichkeitsarbeit/Sonderprojekte,
Datenbank-entwicklung, Zusammenarbeit mit Bezirken, Quartiersmanagement, freie
Atelierhäuser, Ei-gentümer, Investoren
Insgesamt
betrugen die Verwaltungs- und Ent-wicklungskosten für Ateliers 342.186,22 € im
Jahr 2003. 2004 sind Kosten in Höhe von 343.803,29 € geplant:
Atelierbüro
beim Kulturwerk des BBK 150.800,70 €
GSE: 6,5 % Verwaltungskosten
111.701,26 €
GSE: weitere Personal- u. Sachkosten
81.301,33 €
343.803,29
€
Es
wäre unangemessen, diese Kosten insgesamt nur ins Verhältnis zu dem von der
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur geförderten
Atelieranmietprogramm zu setzen. Eine sinnvolle Kennzahl zur Beurteilung der
Effizienz könnte die Zahl der strukturell gesicherten Ateliers im Ver-hältnis
zum Personal- und Verwaltungsaufwand sein. Bei 859 strukturell gesicherten
Ateliers in Berlin beträgt der organisatorische Aufwand pro gesicherte Atelier
400 € im Jahr. Berücksichtigt man beim
Atelierbüro nur die Stellenanteile, die für die Betreuung des
Atelieranmietprogramms zur Verfü-gung stehen, 50 % der Sachkosten des
Atelierbüros und sämtliche Kosten der GSE, so ergibt sich bei 365 betreuten
Ateliers im Anmietprogramm ein organisatorischer Aufwand von ca. 656 € pro
Atelier im Jahr. Verwertbare Vergleichszahlen aus anderen Städten liegen nicht
vor, weil der organisatorische Aufwand meistens nicht erfasst wird. Lediglich
Düsseldorf gibt an, dass die städtische Wohnungsge-sellschaft
dort 180 € pro Atelier im Jahr erhält, und die Hamburger Kulturbehörde
vergibt die Verwal-tung des Atelierhauses für 230 € pro Atelier im Jahr an eine
Verwaltungsgesellschaft. Hierbei handelt es sich aber ausschließlich um Kosten
der Hausver-waltung.
Es
besteht kein Zweifel daran, dass die Mitarbei-terinnen und Mitarbeiter des
Atelierbüros und der GSE sich in ihrem Arbeitsgebiet engagieren. Die Künstler
zeigen sich mit der Betreuung zufrieden. Dennoch stellt sich die Frage, ob zeitaufwendige
Abstimmungen zwischen GSE und Atelierbüro und die gemeinsame Besichtigung neuer
Objekte nicht minimiert werden könnten. Das Atelierbüro gibt je-doch an, dass
der Aufwand dafür 2003 nur ins-gesamt 20 Mannstunden betragen habe.
Aus
der Sicht der Senatsverwaltung für Wissen-schaft, Forschung und Kultur sind
qualitative Stär-ken des Atelierbüros die Betreuung der Künstlerin-nen und
Künstler, die Projektentwicklung, die Akquisition von neuen Ateliers, Objekten
und För-derungen, die internationale Vernetzung und die innovativen Impulse des
Atelierbeauftragten. Unter den Ateliersuchenden werden laufend
Interessenten-befragungen durchgeführt, so dass differenzierte Aussagen über
die Bedürfnisse der Künstler vor-liegen. Über die Bewerberzahlen wurde dagegen
bisher keine regelmäßige Statistik geführt. Eine ge-schlechtspezifische
Datenauswertung liegt ebenfalls nicht vor, so dass nicht erkennbar ist, in
welcher Weise Künstlerinnen, deren Einkommen durch-schnittlich niedriger ist
als das ihrer männlichen Kollegen, von der Berliner Atelierförderung
pro-fitieren.
Die
Öffentlichkeitsarbeit ist verbesserungswür-dig. Die Internetpräsentation der
Atelierangebote ist zwar benutzerfreundlich, aber wegen der ausschließ-lichen
Anbindung an das Kulturwerk des BBK über Suchmaschinen schwer zu erreichen.
Dass
die Schwächen der Berliner Atelierförde-rung erst im Zuge der Evaluierung
festgestellt wur-den, ist die Folge eines fehlenden Controllings bei der
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Sie hat ihre
Aktivitäten bisher auf die Mitwirkung beim operativen Alltagsgeschäft des
Atelieranmietprogramms konzentriert. Die Steue-rungsrunden mit der GSE und dem
Atelierbüro funk-tionieren, ebenso die Zusammenarbeit mit dem Atelierbeirat.
Die Verwendung der Fördermittel wird nach dem üblichen Verfahren überprüft. Die
Einrichtung eines Controllings, das eine regelmäßige Erfassung des Bedarfs,
Leistungsmessung und strategische Weiterentwicklung der Atelierförderung
ermöglicht, ist dringend erforderlich. Dabei muss es um die Sicherung von
Ateliers in Berlin insgesamt und nicht nur um das Anmietprogramm gehen.
Die
Aufgaben des Atelierbüros müssen in Zu-kunft präziser festgelegt werden. Die Senatsverwal-tung
für Wissenschaft, Forschung und Kultur wird dem Kulturwerk des BBK eine entsprechende
Dienstleistungsvereinbarung für die Dauer von 5 Jahren anbieten. Die in der
Dienstleistungsverein-barung festzulegenden Aufgabenfelder werden vor allem die
Beratung von Künstlerinnen und Künst-lern, die Organisation der
Ateliervergabeverfahren, Ateliervermittlung, Erschließung neuer Ateliers,
Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation von künstleri-schen Produktionen aus den
geförderten Ateliers, internationale Zusammenarbeit, Berichtswesen und der
Abschluss von Zielvereinbarungen sein.
Die Verwaltung
von Künstlerateliers ist keine ministerielle Aufgabe. Deshalb soll die Verwaltung
der Ateliers im Fachvermögen der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und
Kultur in Zukunft nicht mehr von der Verwaltung selbst sondern von einem
Dienstleister übernommen werden.
7. Initiativen zur Erschließung weiterer Ateliers
7.1 Landeseigene
Gebäude: Leerstehende Schu-
len und Kindertagesstätten
Für eine Ateliernutzung ist
die Bewirtschaftung von Gebäuden im öffentlichen Eigentum durch die GSE bereits
erprobt: Grundlage ist jeweils ein Ver-waltervertrag mit dem Eigentümer, in dem
neben branchenüblichen Regelungen festgelegt ist, dass die Objekte sich aus den
eigenen Erträgen finanzieren. Die erzielten Überschüsse bleiben beim Haus
stehen und können nur für das Haus eingesetzt werden.
Die Miete für die Nutzer
wurde z.B. für das Kul-turhaus Kyffhäuserstraße, in dem sich auch 18 Ate-liers
befinden, wie folgt kalkuliert:
Miete mtl./m²/netto/kalt 1,59 €
Betriebskostenvorauszahlung 2,09 €
Heizkosten mtl./m² 1,25 €
Warmmiete 4,93
€
Eine laufende
Subventionierung der Miete er-folgt nicht.
Leerstehende Schulgebäude
eignen sich beson-ders gut für die Nutzung als Künstlerateliers. Die
Klassenräume haben mit ca. 50 m² die geeignete Größe und einen rechteckigen Raumzuschnitt
mit günstigen Raumproportionen. Raumhöhe, weiträu-mige Treppen und Flure sowie
überbreite Türen sind günstig für die Bearbeitung großer Formate und für
Transporte. Die meisten Räume haben Wasseran-schluss und große Fensterflächen.
Insbesondere die Altbauten haben eine gute Bausubstanz. Die infra-strukturelle
Anbindung in den Wohnbezirken ist gut.
Nach
Auskunft der Senatsverwaltung für Bil-dung, Jugend und Sport stehen derzeit 77
Schulen und Kindertagesstätten leer.
Mit Schreiben
vom 27.01.2004 hatte die Staats-sekretärin für Kultur die städtischen Wohnungsbau-gesellschaften
gebeten, geeignete Objekte für Ate-liernutzungen zu benennen. Parallel dazu
wurde die Gewerbesiedlungs-Gesellschaft (GSG) ebenfalls um Benennung geeigneter
Objekte gebeten, leider ohne Rückmeldung. Insgesamt wurden 181 Objekte be-nannt,
die vom Atelierbüro auf ihre Eignung über-prüft wurden: Für 72 Objekte konnte
das Atelierbüro keine detaillierten Informationen beschaffen, so dass eine
Einschätzung nicht möglich war. 47 Objekte waren zu teuer, 54 Objekte waren
zuzüglich Neben-kosten zu teuer. 8 Objekte eignen sich für eine Ate-liernutzung
und hatten einen günstigen Mietzins (ausführliche Informationen Anlage 6).
Der
Liegenschaftsfonds bietet Flächen des ehe-maligen Rotaprint-Geländes im Bezirk
Mitte für ei-ne Ateliernutzung an. Darüber hinaus wird ein Ob-jekt in der
Freienwalder Straße in Hohenschön-hausen, in der Plauener Straße 160 in
Lichtenberg und eine Schule in der Böcklinstraße (Friedrichs-hain) angeboten.
In einem Gespräch zwischen dem Geschäftsführer des Liegenschaftsfonds und dem
Atelierbeauftragten am 22. Juni 2004 wurde verab-redet, geeignete Objekte
gemeinsam zu untersuchen. Dabei sollen auch Nutzungs- und Erwerbskonzepte auf
Ertragswertgrundlage wie Genossenschafts- und Investorenmodelle geprüft werden.
Am 4. Juni 2004 fand auf
Initiative des Vorsit-zenden des Hauptausschusses eine Atelierbörse der
öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, des Lie-genschaftsfonds und der
Berliner Immobilienmana-gement GmbH (BIM) statt. Die große öffentliche Resonanz
dokumentiert den nach wie vor vorhan-denen Bedarf an Ateliers.
Als Ergebnis berichtet die
BIM, dass im ehe-maligen Krankenhaus Moabit, das langfristig zu einem
Gesundheitszentrum ausgebaut werden soll, 780 m² Nutzfläche an Künstlerinnen
und Künstler zunächst für sechs Monate vergeben werden konn-ten.
Die public relations für die
Atelierbörse waren sehr gut und zeigen, wie das Thema Ateliers in Zu-kunft
imagefördernd für Berlin als Stadt der Künstler genutzt werden könnte.
8. Konsequenzen
·
Der
finanzielle Aufwand für Ateliers im Atelier-anmietprogramm ist hoch. Deshalb
sollen mit-telfristig, mit Auslaufen ungünstiger Mietver-träge, bis zu 50 % der
Mittel für Investitions-maßnahmen in leerstehende öffentliche Gebäu-de zur
Verfügung gestellt werden. Damit können bezahlbare Ateliers in leerstehenden
landeseigenen Gebäuden zu günstigen Mieten gesichert werden. Die Überlassung
erfolgt auf der Grundlage der vom Abgeordnetenhaus beschlossenen Regelung über
die Zwischennut-zung von leerstehenden Immobilien des Landes und zu den dort
geregelten Bedingungen. Zu prüfen ist, inwieweit eine Umsteuerung der
För-derung von Mietsubventionen in Investitionen durch die Übertragbarkeit der
Mittel gefördert werden kann. Dem Abgeordnetenhaus ist hierzu gesondert zu
berichten.
·
Geförderte
Ateliers können nicht für alle Künst-ler zur Verfügung gestellt werden. Die
Dauer der Förderung von bildenden Künstlerinnen und Künstlern im
Atelieranmietprogramm wird auf maximal 8 Jahre begrenzt. Für Künstlerinnen und
Künstler, deren Ateliers bereits länger als acht Jahre gefördert werden, sollen
für die Dauer von bis zu zwei Jahren Übergangsrege-lungen gefunden werden. Sie
sollen die Mög-lichkeit bekommen, in die Mietverträge für ihre Ateliers zum
Marktpreis einzutreten. Das gilt insbesondere für solche Ateliers, die von den
Künstlern in das Anmietprogramm eingebracht wurden (sog.
Vertragsüberleitungen). Wenn Mietverträge gekündigt werden, sollen den
be-troffenen Künstlerinnen und Künstler bevorzugt andere Ateliers vermittelt
werden, bzw. sozial-verträgliche Lösungen gefunden werden.
·
Der
organisatorische Aufwand für das Ate-lieranmietprogramm ist hoch. Da Vergleiche
mit anderen Städten nicht aussagefähig sind, soll durch ein Interessenbekundungsverfahren
festgestellt werden, ob günstigere Anbieter auf dem Markt gefunden werden
können. Das In-teressenbekundungsverfahren soll die Leistun-gen der GSE
umfassen.
·
Der
bisher festgelegte Mietpreis von 4,09 € pro m²/brutto/warm im Atelieranmietprogramm
ist für viele Künstlerinnen und Künstler zu hoch. Für Künstler mit sehr
niedrigen Einkommen, insbesondere für ältere Künstlerinnen und Künstler, soll
ein Kontingent von besonders preisgünstigen Ateliers angeboten werden.
·
Der
Verdienst von Künstlerinnen liegt unter dem ihrer männlichen Kollegen. Es soll
in Zu-kunft regelmäßig ermittelt werden, in wieweit Frauen an der Förderung
partizipieren. Der Träger wird verpflichtet, das Gender Main-streaming
einzuführen.
·
Bisher existieren zwei Gremien für die Vergabe von Ateliers, der von
der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur berufene
Atelierbeirat für das Atelieranmietprogramm und die von der
Mitgliederversammlung des Berufsverbands Bildender Künstler Berlins ge-wählte
Fachkommission für alle anderen Ate-liers mit Belegrechten. Der Atelierbeirat besteht
aus 10 Mitgliedern. Je ein Mitglied wird von der Akademie der Künste, der Neuen
Gesellschaft für bildende Kunst, dem Neuen Berliner Kunstverein und den Kulturämtern
der Bezirke vorgeschlagen. Der BBK schlägt 5 Mitglieder vor. Eine unabhängige
sachverständige Person wird direkt vom Senator für Wissenschaft, For-schung und
Kultur benannt. Die Fachkom-mission setzt sich ausschließlich aus Künstlern zusammen.
Sie soll aus 10, höchstens 13 Mit-gliedern bestehen. 10 Mitglieder werden von
der Mitgliederversammlung des BBK gewählt, 3 können von anderen
Künstlerverbänden be-nannt werden. Zukünftig sollen Beirat und Kommission zu einem
Atelierbeirat zusammen-geführt und vom Senator berufen werden. Eine Konzentration der Vergabe von Ateliers auf ein
Gremium führt zu mehr Transparenz, weil sich hier das Wissen über die Ateliersituation
insgesamt akkumuliert.
·
Die Steuerung und Prüfung der Senatsver-waltung für Wissenschaft, Forschung
und Kul-tur beschränkt sich bisher auf das operative Geschäft des
Atelieranmietprogramms. Es soll ein Controlling eingerichtet werden, das eine
strategische Steuerung der Atelierförderung der Kulturverwaltung und einen
Überblick über die Atelierbestandsentwicklung ermöglicht. Die Aufgaben des
Atelierbüros werden in einer Dienstleistungsvereinbarung festgelegt.
·
Berlin
zieht bildende Künstlerinnen und Künst-ler aus aller Welt an. Die guten
Arbeitsmög-lichkeiten für Künstlerinnen und Künstler sollen
öffentlichkeitswirksamer vertreten und für das Image Berlins als Kulturstadt
genutzt werden.
·
Bildende
Künstlerinnen und Künstler, die ein öffentlich gefördertes Atelier erhalten
sollten dafür eine Gegenleistung erbringen. Es wird erwartet, dass sie bereit
sind, ihre Arbeitsergeb-nisse innerhalb von zwei Jahren öffentlich zu
präsentieren. Dies ist zukünftig in den Unter-mietverträgen festzulegen.
·
Die im Haushaltsjahr 2005 veranschlagten Mittel
sollen im Rahmen des dargestellten Kon-zepts zur Schaffung und Sicherung von
Ar-beitsräumen für professionelle bildende Künst-lerinnen und Künstler
eingesetzt werden.
Wir bitten, dem
dargestellten Maßnahmekonzept zuzustimmen und die qualifizierte Sperre für
Kapitel 1730 Titel 686 15 (rote Nummer 2389) aufzuheben und den Beschluss damit
als erledigt anzusehen.
Berlin, den 15. Februar 2005
Der Senat von Berlin
Klaus
W o w e r e i t
Regierender Bürgermeister
Dr. Thomas F l i e r l
Senator für Wissenschaft, Forschung
und Kultur
Anlagen:
1. Ateliers Berlin
1.1 Senatsverwaltung für Wissenschaft,
Forschung und Kultur
1.2 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
1.3 Bezirke
1.4 Wohnungsbaugesellschaften
1.5 Freie Träger
2. Investitionen im
Rahmen des Atelieranmietprogramms
und aufgegebene Objekte
3. Anmietungen im
Rahmen des Atelieranmietprogramms
4. Atelierförderung in
deutschen Großstädten
5. Atelierförderung in
europäischen Großstädten
6. Angebote der
Wohnungsbaugesellschaften und des Liegenschaftsfonds
Ausschuss-Kennung
: Kultgcxzqsq